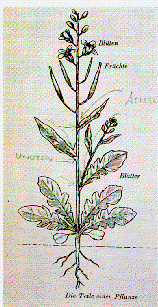Allgemeines
Das Leben fiel nicht vom Himmel
Martin Neukamm - Martin.Neukamm@ch.tum.de
Moderne Erkenntnisse der Naturwissenschaft über die Entstehung des Lebens, Evolution und
Kosmologie.
http://thor.tech.chemie.tu-muenchen.de/~neukamm/leben.html
Sterben,
um leben zu können
Christoph Borner - christoph.borner@unifr.ch
Ein paradoxes Phänomen? Ueberhaupt nicht! Jeden Tag sterben
in unserem Körper abertausende von Zellen, um uns vor
lebensgefährlichen Fremdstoffen, wie Bakterien, Viren,
Giften, UV-Strahlung, Krebsgeschwüren, etc. zu schützen.
Dies geschieht dank eines komplexen, in jeder Zelle
vorgegebenen Todesprogrammes, welches von aussen je nach
Bedarf an- oder abgeschaltet werden kann.
Schon
während der vorgeburtlichen Entwicklung bestimmt der
programmierte Zelltod das spätere Leben. Nervenzellen werden
im Überschuss produziert und nur diejenigen überleben,
welche korrekte Verbindungen herstellen. Der Rest stirbt
mittels eines zelleigenen Todesprogrammes. Fehlt dieses
Programm, werden Zellen am Leben erhalten, die falsche
Nervenverbindungen herstellen und so Bewegungs-, Sinnes- und
Denkabläufe des heranwachsenden Menschen beeinträchtigen.
Sobald das Individuum geboren ist, muss es sich vor
Fremdstoffen schützen können. Dies wird durch die Zellen des
Abwehrsystems bewerkstelligt. Doch wiederum werden am Anfang
zuviele Abwehrzellen produziert und nur diejenigen sollen überleben,
die Fremdstoffe erkennen und vernichten. Die anderen, welche
eigene Körpersubstanzen angreifen, müssen sterben, um
Autoimmunkrankheiten zu vermeiden. Selbst die Zellen, die
Fremdstoffe vernichten, müssen nach ihrer Aufgabe sterben,
damit sie nicht unkontrolliert weiterwachsen oder den Körper
mit entzündungsfördernden Substanzen überschwemmen. Nur ein
kleiner Prozentsatz dieser Zellen überlebt als Gedächtniszellen,
welche sich bei erneutem Kontakt mit dem Fremdstoff an diesen
erinnern und ihn sofort vernichten können. Schliesslich
findet programmierter Zelltod in allen Zellen statt, die mit
der Aussenwelt in direktem Kontakt stehen (so z. B. die obere
Zellschicht der Haut).
http://www.unifr.ch/spc/UF/98mars/borner.html
Wie
sterben Zellen? Neue Erkenntnisse
Christoph Borner - christoph.borner@unifr.ch
Es ist schon lange bekannt, dass sich die Zellen eines
menschlichen Organismus nach einem definierten Programm
entwickeln und vermehren. Dies stellt sicher, dass Zellen nur
an dem Ort des Körpers anwesend und aktiv sind, wo sie ihre
angestammte Funktion ausüben müssen. Was passiert aber mit
dem Rest der Zellen, die zum Beispiel geschädigt werden, sich
am falschen Platz einnisten oder ihre Aufgabe bereits erfüllt
haben und nicht mehr gebraucht werden? Liesse man diese
weiterleben, könnten sie zu bösartigen Geschwüren, wie
Krebs, heranwachsen.
Es hat sich kürzlich
herausgestellt, dass solche «unerwünschten» Zellen
absterben, und dass diesem Zelltod auch ein Programm zu Grunde
liegt. Dieses Programm ist im Innern jeder lebenden Zelle mehr
oder weniger vorgegeben und muss nur noch wie eine Maschine
von aussen her an- oder abgeschaltet werden. Diese «Todesmaschine»
ist komplex (sonst würde sie fälschlicherweise betätigt) da
sie von etlichen Molekülen gesteuert wird.
Die Ergebnisse
der Freiburger Forschungsgruppe bestätigen, was US Forscher kürzlich
gefunden haben. Eine Substanz, namens «Cytochrome c», welche
im Innern der Mitochondrien für die Atmung und
Energiegewinnung, und daher für das Ueberleben der Zelle
verantwortlich ist, kann sich auch am Auslösen des Zelltodes
beteiligen (gegensätzliche Doppelfunktion). Dies geschieht
dann, wenn diese Substanz aufgrund einer äusseren Einwirkung
aus den Mitochondrien in die Zellflüssigkeit (Zytoplasma)
austritt und dort die «Todesmaschine» anschaltet.
http://www.unifr.ch/spc/comm_press/98/biochemie.html
 Autonomie
in Biologie und Technik Autonomie
in Biologie und Technik
E. von Goldammer, J. Paul - vgo@xpertnet.de,
jpaul@xpertnet.de
Kognitive Netzwerke - Artificial Life - Robotik
Der Versuch, eine wissenschaftliche Beschreibung lebender
Systeme im Sinne einer "ganzheitlichen", d.h.
nicht-reduktionistischen ´Theorie des Lebens´ zu entwickeln,
hat in den 70er Jahren zu einem fundamentalen Wechsel des bis
dahin gültigen wissenschaftlichen Paradigmas einer strikten
Trennung von Beobachter und Beobachtetem geführt. Der
Beobachter wird zum "Teil des zu beschreibenden
Systems" /1/:
"Ein
lebender Organismus ist eine selbständige autonome,
organisatorisch geschlossene Wesenheit,
und (1)
ein
lebender Organismus ist selbst Teil, Teilhaber und
Teilnehmer seiner Beobachtungswelt."
Diese
beiden sich zueinander komplementär verhaltenden Aussagen
setzen zunächst einmal ´Autonomie´, d.h. ´Selbst-Regelung´
für lebende Systeme notwendig voraus. Dabei ist der Begriff
der ´Selbst-Regelung´ synonym mit dem Ausdruck ´Regelung
der Regelung´, und das bedeutet in der Terminologie der
Kybernetik:
"Ein
lebendes System regelt seine Regelung (selbst)." (2)
Die Akzeptanz
einer derartigen Aussage hat erhebliche Konsequenzen für die
(kybernetische) Beschreibung autonomer Systeme, denn sie
verlangt die organisatorische Geschlossenheit autonomer
Systeme im Sinne der "Closure Thesis" /2/:
Closure
Thesis: (3)
"Every
autonomous system is organizationally closed.
. . . organizational closure is to describe a system with
no input and no output . .."
Diese
Anschauung ist mit dem Wiener´schen Begriff des
"Feedback" schlechthin unvereinbar. Hier wird der Übergang
von der klassischen Kybernetik (1. Ordnung), deren
Beschreibungsobjekte ausschließlich ´Input/Output´-Systeme
sind, zur "Kybernetik 2. Ordnung" deutlich, die es
ganz offensichtlich mit (operativ) geschlossenen, d.h.
autonomen Systemen zu tun hat.
Der
epistemologisch entscheidende Punkt resultiert aus der
Erkenntnis, daß ´operative Geschlossenheit´ und ´Autonomie´
lebender Systeme unvereinbar sind mit einer Beschreibung des
Systems aus seinem (vom Beobachter festgelegten)
System/Umgebungs-Verhältnis heraus. Mit anderen Worten, die
durch den Beobachter definierte Abgrenzung von System und
Umgebung, durch die ein Input/Output-Verhältnis erst
definiert wird, ist immer unterschiedlich zur Grenzbildung,
die das autonome System durch seine (operative)
Geschlossenheit relativ zu allen anderen Systemen erzeugt.
Parallel
zur Entstehung der besonderen Rolle des Beobachters in der
Konzeption einer ´Theorie lebender Systeme´ steht in diesem
Kontext die Fragestellung nach der Relation von System und
Umgebung, die wiederum unter dem Aspekt der kognitiven Fähigkeiten
als primordialer Eigenschaft von ´Leben überhaupt´
verstanden wird /3/:
"Lebende
Systeme sind kognitive Systeme, und Leben als Prozeß ist
ein Prozeß der Kognition. Diese Aussage gilt für alle
Organismen, ob diese ein Nervensystem besitzen oder
nicht." (5)
Auf
dem Weg zu einer ´Theorie lebender Systeme´ kommt der
Konzeption der ´Autopoiese´ von Maturana und Varela
/4/
eine zentrale Rolle zu. Dabei stellt die ´Theorie
autopoietischer Systeme´ den Versuch einer rein semantischen,
d.h. nicht-formalen Theorie lebender Systeme dar, mit der erklärten
Absicht, eine biologische (nicht-physikalistische)
Begrifflichkeit lebender Systeme zu entwickeln - das ist ihr
Verdienst. Was auf der Basis einer rein semantischen Theorie
jedoch nicht gelingen kann, ist eine Symbiose von Computer-
und Biowissenschaften im Sinne der Simulation biologischer
Systeme und der daraus resultierenden Konstruktion
entsprechender technischer Artefakte - das ist das Problem.
Während alle
bis heute bekannten Modelle der Neuroinformatik ausschließlich
klassische Input/Output-Systeme - also offene Systeme -
beschreiben, stellen die von der ´Kybernetik 2. Ordnung´
geforderten Modelle biologisch kognitiver Netzwerke
geschlossene Systeme dar. Hier besteht ganz offensichtlich ein
unvereinbarer Widerspruch in der Vorstellung zwischen ´offenen´
und ´geschlossenen´ Systemen, Netzwerken oder Modellen der
Beschreibung. Entscheidend ist dabei die Erkenntnis, daß nur
geschlossene Systeme eine Umgebung besitzen können, während
offene Systeme prinzipiell keine Umbebung besitzen.
Physikalische Systeme sind "offene" Systeme.
Wird also nach
einem Modell zur Beschreibung kognitiver Prozesse gesucht,
dann muß dieses den Aspekt der ´Geschlossenheit´
beinhalten, denn
K o g n i
t i o n ist die Fähigkeit eines Systems, aus eigener
Leistung zwischen sich
und seiner Umgebung eine Unterscheidung treffen zu können.
(6)
Lebende Systeme
werden permanent von Energie durchströmt, d.h. in sie strömt
sowohl Energie hinein wie auch heraus. Was dagegen niemals aus
ihnen heraus oder in sie hineinströmt, ist Information und
zwar auch dann nicht, wenn Elektroden im Gehirn angelegt
werden. Es strömt immer nur Energie, das gilt auch für den
Wahrnehmungsapparat oder die vom Experimentator im Gehirn
angelegten Elektroden.
Da durch jede
Messung die Veränderung zwischen einem Anfangs- und einem
Endzustand bestimmt wird, reduziert jede experimentelle
Wissenschaft, bei der die Messung im Vordergrund steht, ein
System zu einem offenen (Teil-) System, bei dem es einen ´Anfang´
und eine ´Ende´, einen ´Input´ und einen ´Output´ gibt.
Das sind Begriffe, die nur im Zusammenhang mit offenen
Systemen einen Sinn ergeben, und damit wird auch klar, warum
in den klassischen Naturwissenschaften der Begriff des ´Systems´
im allgemeinen nur eine untergeordnete Rolle spielt, von ´Geschlossenheit´
zu sprechen ist in diesem Kontext sinnlos.
So reduziert
sich aus wissenschaftlich konzeptioneller Sicht das System ´Affe´,
bei dem beispielsweise die Hirnaktivität als Funktion (vom
Experimentator) vorgegebener äußerer optischer Reize durch
Elektroden gemessen wird, auf das System eines lebenden,
nicht-trivialen Signal- oder Datenfilters, bei dem ein
lebendes neuronales Netzwerk eingesetzt wird. Durch die
experimentelle Anordnung ist das System ´Affe´ bzw. dessen
Gehirn (für den Experimentator) zu einem offenen System
reduziert worden. Über den (visuellen) Wahrnehmungs- oder
Kognitionsprozeß, der sich im System ´Affe´ während der
experimentellen Situation abspielt, erfährt der
Experimentator durch solche oder ähnlich durchgeführten
Messungen nichts. An dieser Situation würde sich natürlich
auch dann nichts ändern, wenn experimentell die Möglichkeit
bestünde, die Aktivität jedes einzelnen Neurons bis ins
letzte Detail vermessen zu können.
Die
"Festlegung" physikalischer Systeme als
"offene Systeme" ist natürlich keine bloße Marotte
der Physiker, sondern entspringt dem Bemühen,
physikalisch-chemische Systeme und Prozesse auch mathematisch
beschreiben zu können. Dabei stellt die Mathematik als
formale Sprache ein extrem effizientes Hilfsmittel für die
wissenschaftliche Kommunikation dar. Die formale Beschreibung
eines geschlossenen Systems im Sinne der ´Closure Thesis´
(vgl. Aussage 3) ist auf der Basis der klassischen Mathematik
nicht möglich /6/
/7/.
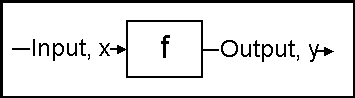
Abb.1
: Prinzip eines "Trivialen Automaten"
Triviale
Automaten sind: 1) synthetisch determiniert; 2) analytisch
determinierbar; 3) vergangenheitsunabhängig; und 4)
vorhersagbar. Automaten dieser Art sind nicht nur
langweilig, mit ihnen könnte man noch nicht einmal einen
herkömmlichen Computer bauen.
In der Abb.2
ist ein Automat angegeben, der sich von seinem trivialen
Pendant dadurch unterscheidet, daß die Operationen dieser
Maschine von den jeweiligen "inneren Zuständen" z
der Maschine abhängen. Der Maschinentyp wird im folgenden mit
dem Akronym NTA (Nicht_Trivialer_Automat) abgekürzt.
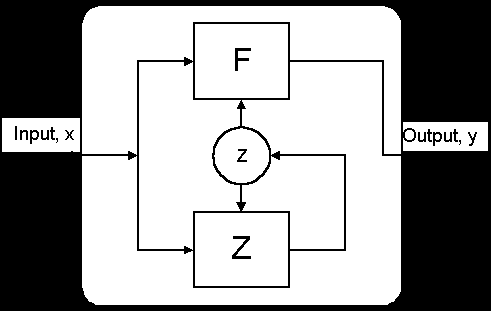
Abb.
2 : Prinzip eines "Nicht-Trivialen-Automaten"
Maschinen
dieser Art werden in Ref.6 als 1) synthetisch determiniert,
2) analytisch unbestimmbar, 3) vergangenheitsabhängig und
4) unvoraussagbar bezeichnet.
Es ist in
diesem Kontext nicht weiter relevant nach dem
wissenschaftlichen Nutzen von Messungen der Hirnaktivität bei
Tieren zu fragen, das steht hier nicht zur Debatte. Fest steht
jedoch, daß auf diese Weise keine Erkenntnisse über den
Prozeß der Kognition gewonnen werden können, der Vergleich
mit einem NTA liegt auf der Hand. Wenn aber die Fähigkeit zur
Kognition ein wesentliches Merkmal lebender Systeme ist, dann
tragen Experimente dieser Art, wenn überhaupt, nur wenig zu
einer "Theorie lebender Systeme" bei und damit nützen
sie einem Ingenieur, der kognitive Fähigkeiten in einem
technischen System abbilden möchte, nichts.
Das
Problem das es zu lösen gilt, ist seit mehr als 2000 Jahren
unter verschiedenen Etiketten wie die ´Dichotomie von Geist
und Materie´ oder die ´Subjekt-Objekt-Spaltung´ bekannt.
Heute tritt es als das Problem einer Verknüpfung
verschiedener Beschreibungsdomänen erneut auf, nämlich
einmal der physikalisch-chemischen Prozesse auf der einen
Seite und der kognitiven Prozesse auf der anderen Seite.
Der Stand
wissenschaftlicher Erkenntnis stellt sich heute i.allg. so
dar, daß von Autonomie, Kognition, Lernen usw. im Kontext
biologischer und technischer Systeme zwar gesprochen, die
Problematik der Geschlossenheit jedoch nicht zur Kenntnis
genommen wird. Dabei wird in aller Regel auch übersehen, daß
autonome Systeme nicht nur über kognitive sondern auch über
volitive Fähigkeiten verfügen müssen /19/.
Damit nimmt die Komplexität des Problems der (formalen)
Beschreibung autonomer Systeme noch erheblich zu.
Begriffe wie ´Offenheit´
und ´Geschlossenheit resultieren nicht aus experimentellen
Messungen, sondern sind wie ´rechts´ und ´links´
standpunktabhängige Beschreibungskategorien, die erst im
Rahmen einer formalen Darstellung ihre eigentliche Bedeutung
erlangen. Alle räumlich-geometrischen Vorstellungen sind
somit für die begriffliche Fassung einer Theorie autonomer
Systeme völlig obsolet. Jede experimentelle Messung reduziert
das zu untersuchende Objekt zu einem System mit einem Anfangs-
und einem Endzustand und damit zu einem "offenen
System", an dem generell nur physikalisch-chemische
Parameter gemessen werden können. Kognitive Prozesse lassen
sich damit nicht erfassen, d.h. die Thematik von
"Kognition und Autonomie" geht auf diesem Weg
verloren.
Was
benötigt wird,
ist ein geeigneter Kalkül zur Entwicklung eines Modells
biologisch kognitiver Netzwerke, der eine simultane (formale)
Darstellung offener und geschlossener Netze (Systeme)
erlaubt. Dafür werden jedoch wenigstens drei
unterschiedliche, miteinander jeweils vermittelte
Beschreibungspositionen benötigt, aus denen heraus sich das
Modell biologisch kognitiver Netze (Systeme)
- als offene
Netzwerke (Systeme-physikalisch-chemische Beschreibungsdomäne)
- als
geschlossene Netzwerke (Systeme-kognitive Beschreibungsdomäne)
und
- als
Relation von offenen und geschlossenen Netzwerken (Systemen)
widerspruchsfrei
thematisieren läßt. Die wissenschaftliche Umsetzung dieser
Forderung stellt primär ein wissenschaftslogisches,
interdisziplinär-orientiertes Problem dar, worauf in der
Vergangenheit schon mehrfach hingewiesen wurde /20/
und begründet gleichzeitig das formale Fundament einer
modernen allgemeinen Systemtheorie.
http://www.vordenker.de/autonomie/autonomie.htm
|