GRUNDLEGENDES
Was fordert echte Schauspielkunst von uns, und was kann sie uns ganz persönlich geben? Sie verlangt von uns, in eine Rolle zu schlüpfen, sie glaubhaft zu verkörpern, und sie schenkt uns, wenn uns das halbwegs gelingt, Freude am Spiel, Befriedigung über das, was wir zustande gebracht haben – und nicht zuletzt zurecht den Applaus, die Anerkennung des Publikums, das sich seinerseits durch unsere Darstellung befriedigt fühlt. Wie aber kann man es anstellen, daß das gelingt? Damit, daß wir den Text einigermaßen sicher und ohne zu stocken herunterleiern, ist es wohl noch nicht getan, obwohl die Textsicherheit zweifellos die wichtigste Voraussetzung ist, um überhaupt an die Rollenarbeit heranzutreten.
Das Textstudium
Je früher und je gründlicher man den Text beherrscht, desto besser ist es für die Probenarbeit. Ein einigermaßen freies Bühnenspiel kann sich erst entfalten, wenn man nicht mehr mit dem Textheft über die Bühne läuft, blind für alles, was um einen geschieht und taub für das, was die anderen Schauspielkollegen aus ihrer Rolle heraus zu sagen haben, weil man krampfhaft versucht, die Zeile in seinem Manuskript nicht zu verlieren. Außerdem kann man mit einem Text erst wirklich etwas anfangen, wenn man ihn in- und auswendig kennt. Wie aber stellt man das an?
Zuerst muß man sich einen verbindlichen Termin setzen, bis zu dem man den Text beherrschen muß, und der sollte nicht erst zwei Wochen vor der Premiere liegen, sondern so früh als möglich. Der Profischauspieler wird gezwungen, einen bestimmten Termin einzuhalten, und er hat es dadurch sogar leichter als der Amateur, der ihn ganz freiwillig einhalten muß – was aber soviel heißt, wie daß er sich selbst zwingen muß. Textstudium erfordert also möglichst eiserne Disziplin. Damit beginnt zugleich der eigentlich unangenehme Teil der ganzen Schauspielkunst, der aber dennoch einen wesentlichen Gewinn abwirft, den man nicht unterschätzen sollte: was man derart an Disziplin mühsam aufbringt, steht einem später als ganz reale schöpferische Willenskraft für das Rollenspiel zur Verfügung. Solange man noch mit dem Text hadert, wird das Spiel immer blaß und ausdruckslos wirken und einen selbst wenig erfreuen und befriedigen – das weiß wohl jeder, der schon einmal auf einer Bühne gestanden ist. Was man später an Freude gewinnen will, muß man erst durch Mühe erkaufen – daran führt kein Weg vorbei.
Damit man den gesetzten Termin einhalten kann, muß man sich den Text in geeignete Portionen einteilen, die man gerade mit seiner Gedächtniskraft bewältigen kann. Das kann eine Seite sein, eine Szene, ganz nach den persönlichen Möglichkeiten. Gleichgültig ist es dabei, ob man jeden Tag ein Stückchen lernt oder lieber einmal wöchentlich eine größere Portion. Jeder wird selbst herausfinden, wie er am besten fährt. Nicht verzichten sollte man aber darauf, den gelernten Text einige Zeit lang möglichst täglich zu wiederholen. Das muß keineswegs der ganze Rollentext sein, sondern eben jene Portion, die man zuletzt studiert hat. Erfahrungsgemäß genügen dafür 10 bis 15 Minuten täglich – und die kann man in der Regel aufbringen, wenn man nur will, selbst wenn man ein sehr vielbeschäftigter Mensch ist und den Kopf mit hunderttausend anderen Dingen voll hat. Man muß regelrecht mit dem Text leben; und so wie wir auch regelmäßig essen müssen, sollte es uns ein regelmäßiges Bedürfnis werden, den Text zu wiederholen. Genau besehen wird man sich so den Text müheloser, rascher und mit insgesamt geringerem Zeitaufwand aneignen, weil man einfach effektiver vorgeht – und das ist in einer von Überfluß an Zeitmangel geprägten Zeit wie der unseren wohl auch nicht ganz unwichtig. Am besten wird man dabei vorankommen, wenn man den Text nicht zu einer beliebigen Zeit wiederholt, sondern täglich möglichst zum exakt gleichen Zeitpunkt. Das Gedächtnis läßt sich nämlich nur rhythmisch trainieren, und je strenger man den Rhythmus einhält, desto sicherer kommt man weiter. Sehr gute Erfahrungen wird man machen, wenn man den Text kurz vor dem Schlafengehen noch einmal durchgeht; dann nimmt man ihn nämlich in den Schlaf mit hinein, und erst im Schlaf festigt sich das Gedächtnis wirklich. Wenn man dann am nächsten Tag aufwacht und nochmals kurz den Text aus dem Gedächtnis aufsteigen läßt, wird man bald bemerken, daß er dann viel besser sitzt als am Abend zuvor. Überhaupt beherrscht man das Gelernte erst, wenn man es zwei oder drei Nächte überschlafen hat. Damit sich das, was man gelernt hat, wirklich einprägt, muß man es zeitweilig völlig im Unbewußten versinken lassen – und das gelingt eben am besten im Schlaf. Am schlechtesten ist es, wenn man krampfhaft versucht, das Erlernte möglichst beständig an der Oberfläche des Bewußtseins zu halten. Damit wird löscht man geradezu seine Gedächtnisfähigkeit aus. Man muß eigentlich beständig sein Bewußtsein vom Gelernten befreien, damit es dann aus der Tiefe des Unterbewußtseins um so souveräner wieder auftauchen kann.
Der Text wird sich umso leichter einprägen, je stärker man dabei als ganzer Mensch aktiv mitwirkt. Es genügt nicht, sich den bloß den Gedankengehalt, die begriffliche Ebene des Textes zu merken. Die ist sogar am unwesentlichsten und hindert uns oft daran, den getreuen Wortlaut in tieferen Schichten unseres Wesens zu verankern. Außerdem versteht man einen anspruchsvollen Rollentext, wenn man ehrlich ist, ohnehin nicht gleich. Das schadet aber gar nichts: irgendwann, wenn man den Text Wort für Wort verinnerlicht hat und ihn jederzeit mit schlafwandlerischer Sicherheit reproduzieren kann, wird sich beinahe von selbst das nötige Verständnis einstellen – und zwar viel gründlicher als das bei bloß oberflächlicher Textkenntnis möglich ist. Den Verstand sollte man also zunächst beiseite schieben und mehr auf den eigentlichen Wortlaut achten, was am besten gelingt, wenn man den Text laut sprechend memoriert – sofern das die häuslichen Mitbewohner ertragen können! Wenn man ihn aber schon nicht laut sprechen kann, etwa wenn man in der U-Bahn sitzt, dann muß man ihn zumindest leise innerlich mitsprechen. Nicht denken soll man den Text, sondern ihn sprechen. Man wird sich dann auch leichter vor einer großen Untugend des Textlernens befreien: wenn man den Text nämlich bloß inhaltlich studiert, wird man immer dazu neigen, ihn später zwar sinngemäß, aber nicht wortgetreu wieder aufleben zu lassen – und darauf kommt es gerade beim Schauspiel an. Die dichterische Qualität eines Stückes liegt ja vorallem in der Wortwahl und –abfolge, die der Dichter verwendet, und nicht ihm gedanklichen Gehalt; der ist nur der Rohstoff, dem der Dichter durch die gewählten Worte erst seine künstlerische Form gibt, und die muß uns ganz besonders am Herzen liegen. Den besten und schnellsten Erfolg wird man erzielen, wenn man während des Textstudiums auf- und abgeht und den dabei laut rezitierten Text auch noch mit ausladenden Gesten begleitet. Das mag zwar einen unbefangenen Beobachter mitunter recht komisch anmuten, aber man erreicht damit, daß sich der Text dem ganzen Gliedmaßensystem einverleibt – und erst dort sitzt er so richtig fest. Es ist nämlich durchaus ein moderner Aberglaube, daß das Gedächtnis bloß im Gehirn sitzt; wahr ist vielmehr, daß unser ganzer lebendiger Organismus an unserer Erinnerungsfähigkeit beteiligt ist, und je tiefer wir das Erlernte in unseren Leib versenken können, desto sicherer taucht es bei Bedarf aus dieser Tiefe wieder auf. Dabei darf man auch nicht glauben, daß das Gelernte so, wie wir es ursprünglich aufgenommen haben, "gespeichert" wird. Tatsächlich funktioniert unser Gedächtnis ganz anders als der digitale Speicher eines Computers. So simpel dieser verglichen mit dem Menschen ist, so kann er doch jederzeit hunderttausende Textseiten blitzschnell und getreu abrufen, was uns Menschen niemals gelingt. Unser Gedächtnis speichert nicht den gelernten Text, er ist als solcher nirgendwo in uns vorhanden, sondern durch das Lernen werden unserem Organismus gewissermaßen Spuren eingegraben, aus denen der Text später aktiv wieder rekonstruiert, nachgebildet werden muß. Daher erfordert ein getreues Gedächtnis auch viel Übung und Disziplin. Unser Gedächtnis, weil es das Erlernte immer wieder neu nachbilden muß, neigt sehr stark dazu, unsere Erinnerungen beständig zu verfälschen.
Jedesmal, wenn wir etwas aus der Erinnerung heraufrufen, erscheint es schon wieder leicht verändert. Unsere Gedächtnisfähigkeit ist nämlich ganz eng verwandt mit unseren Phantasiekräften. Die Phantasie ist eigentlich nur eine gesteigerte und modifizierte Gedächtniskraft, und alles, was wir uns innerlich an phantasievollen Bildern vor die Seele zaubern, ist letztlich immer aus dem Rohmaterial unserer Erinnerungen gewoben. Wenn wir den Text getreu lernen wollen, was wir als Schauspieler unbedingt müssen, müssen wir uns vor jeder unbewußten Phantasterei hüten. Weil das Gedächtnis in unserem ganzen Organismus sitzt und nicht bloß im Gehirn, müssen wir das Erlernte auch mindestens zwei Nächte lang überschlafen, damit es sich wirklich fest in uns verankert. Am ersten Tag sitzt es nämlich tatsächlich noch vorallem im Kopfbereich. Nach der ersten Nacht rutscht es bereits in das rhythmische System, in die Atemtätigkeit und den Herzschlag hinunter, und erst nach der zweiten Nacht dringt es bis zu unserem Stoffwechsel- und Gliedmaßensystem vor. Wir müssen also das Erlernte geradezu im wörtlichen Sinne "verdauen", wir müssen es bis in die Verdauungsregion hinunterbringen, wo es, uns zunächst unbewußt, weiterlebt. Legt sich während des Gedächtnistrainings allzusehr der Verstand quer, verhindert man geradezu, daß das Erlernte genügend stark in den tieferen Regionen unseres Organismus weiterleben kann, wir halten es gleichsam krampfhaft in der Kopfregion fest, um es nur ja nicht wieder zu verlieren – und erreichen so das gerade Gegenteil: wir bekommen überhaupt keine Textsicherheit; der Text wird nur mühsam und kaum vollständig getreu rekonstruiert werden und auch kaum sehr lebendig, sondern eben konstruiert wirken. Man muß den Mut haben, das was wir lernen in der Tiefe unserer Organisation versinken zu lassen, es aus dem Bewußtsein zu entlassen und dem Unterbewußtsein anzuvertrauen, man muß es gleichsam zeitweilig bewußt "vergessen", d.h. aus dem Bewußtsein tilgen, und dem Leib anvertrauen. Von dort taucht es ganz sicher bei Bedarf frisch lebendig und ziemlich getreu wieder auf – und es wird dabei so spontan und ursprünglich wirken, wie wenn es uns gerade jetzt erst eingefallen wäre. Das ist aber gerade für den Schauspieler ganz wichtig, denn nur dann wirkt sein Rollentext echt und unmittelbar und nicht bloß eingelernt. Richtiges Rollenlernen ist damit hochbedeutsam für das spätere Rollenspiel! Und noch etwas verdanken wir der eigentümlichen Natur unseres Gedächtnisses: daß es eng mit den Phantasiekräften verwandt ist, macht es uns zwar nicht leicht, Rollen ganz getreu zu erlernen, aber es öffnet zugleich die Tore zu der Wunderwelt unserer kreativen Phantasie. Wenn der erlernte Text nur tief genug sitzt, wird es uns beinahe mühelos gelingen, ihn Wort für Wort getreu zu reproduzieren – aber wir werden ihn dabei
jedesmal, wenn wir ihn sprechen, mit leicht verändertem Tonfall, mit etwas anderem Tempo und Rhythmus hervorbringen – hier spielt unsere Phantasie ganz unvermerkt und ohne, daß wir uns dabei anstrengen müssen, mit dem gesamten Lautbestand des Textes, variiert den Redefluß auf mannigfaltigste Weise und präsentiert uns dadurch ein ganze Panorama möglicher Gestaltungsformen. Wir brauchen eigentlich nur mehr darauf achten, bei welcher Gestaltung wir uns besonders wohl fühlen und der Rolle gemäß empfinden, und nach und nach wir uns so der Rollencharakter immer lebendiger werden. Wir brauchen diesen Charakter nicht mehr nach dem konstruieren, was wir uns über ihn denken, sondern er entsteht gleichsam immer deutlicher in uns. Und was so entsteht, wird uns auch immer mehr überraschen und vielleicht ganz und gar nicht dem entsprechen, was wir anfangs über die Rolle gedacht haben. Genau so muß es aber auch sein. Nicht wir sollen nach unseren Meinungen und Vorurteilen (und jede Meinung, und wenn es auch die beste und gescheiteste ist, ist notwendig zugleich ein einseitiges Vorurteil) einen Rollencharakter aufbauen wollen, sondern wir müssen den Freiraum in uns schaffen, in dem er seiner Natur gemäß lebendig werden kann. Sonst spielen wir doch nur immer wieder uns selbst in leicht modifizierter Form – und dann sind wir eigentlich bereits keine Schauspieler mehr. "Der Schauspieler irrt, wenn er glaubt, seine Rolle mittels persönlicher Gefühle darstellen zu können. Nicht immer macht er sich klar, daß seine persönlichen Gefühle nur über ihn selbst etwas aussagen, niemals über seine Rolle."
(Cechov, S 125) Wir sollen eine Charakter verkörpern, d.h. wir sollen ihm zum Zweck des Bühnenspiels unseren Körper leihen, damit er für das Publikum sichtbar werden kann; aber seelisch soll sich darin eben dieser uns vielleicht seelisch ganz und gar nicht verwandte Charakter ausdrücken – und nicht wir selbst. Wir selbst dürfen gleichsam nur als aufmerksamer, aber völlig schweigsamer Beobachter daneben stehen. Das wird aber dann zugleich ein ganz besonderer Gewinn für uns sein. Denn wenn es sich auch bei der Rolle um einen mehr oder weniger fiktiven Charakter handelt, so ist er doch, wenn er nur von einem halbwegs guten Dichter geschaffen wurde, soviel vollsaftig Menschliches, daß wir nun geradezu die Chance haben einen anderen Menschen ganz von innen her
kennenzulernen, bis in die intimsten Tiefen seiner Seele, während man im alltäglichen Leben andere Menschen nur von außen her kennenlernen kann und ihr Inneres mehr oder weniger aus ihrer Mimik, Gestik, Sprache usw. erahnen muß. Wir erleben dann hautnah, wie verschieden eigentlich Menschen sein können, wie man die Welt eigentlich auch noch von einem völlig anderen Standpunkt aus betrachten kann, der vielleicht unserem geradezu entgegengesetzt ist. Das kann sehr heilsam sein, denn erfahrungsgemäß glauben die meisten Menschen unbewußt ganz fest daran, daß überhaupt nur ein Standpunkt möglich ist – nämlich der eigene! Indem man so in sich geradezu einen zweiten, völlig eigenständigen Menschen bewußt mit sich herumträgt, lernt man zugleich sich selbst notwendig besser kann. Man lernt geradezu, sich selbst aus der Perspektive dieses anderen Menschen zu betrachten, und man wird dadurch unweigerlich an sich selbst Seiten entdecken, die einem vorher gar nicht bewußt waren. Das ist ein schönes und schreckliches Erlebnis zugleich. Schön, weil wir so manche Fähigkeit und Tugend in uns wecken können, die verborgen in uns schlummert; schrecklich, weil aber auch so mancher versteckte Mangel offenbar wird. Wie bei allen Menschen ist auch unser Wesen recht bunt aus Tugend und Mängel gemischt – und die Mängel, die wir uns bewußt eingestehen, sind normaler gar nicht die wichtigsten. Darum scheuen sich auch viele wie der Teufel vor dem Weihwasser, sich auf eine Rolle voll einzulassen – denn dann läuft man zwangsläufig Gefahr, sich selbst ungeschminkt betrachten zu müssen, und das kann natürlich auch manchmal recht ungemütlich werden. "Und der Mensch versuche die Götter nicht, und begehre nimmer und nimmer zu schauen, was sie gnädig bedecken mit Nacht und Grauen." – könnte man mit Schiller sagen und damit die geheime Lebensmaxime vieler Menschen treffend bezeichnen. Wer aber wirklich Schauspieler im modernen Sinne sein will, kann gerade dem nicht entkommen. Darum gibt es auch wenig wirklich gute Schauspieler und viel mehr, die sich mehr oder weniger gut mit ihrer persönlichen Masche durchlavieren! Jedenfalls sollte man als Schauspiel nicht vollkommen überrascht sein, wenn es zu so einer unvermuteten Selbstbegegnung kommt, und man sich darüber klar sein, daß die uneingestandene Angst davor oft der entscheidende Grund sein kann, warum man in seiner Rollengestaltung nicht weiterkommt. Nebenbei, so unangenehm eine derartige unverhüllte Selbsterkenntnis auch sein mag, schaden kann sie nicht, sondern höchstens auch für das alltägliche Leben nützen. Ehrlich betriebene Schauspielkunst hat halt immer auch einen gewissen autotherapeutischen Effekt und ist vielleicht manchmal besser und jedenfalls preiswerter, als sich beim Psychiater auf die Couch zu legen!
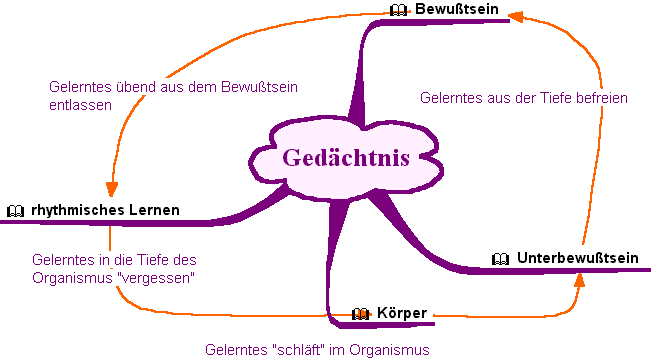
Die Arbeit an der Rolle
Alle bewußte schauspielerische Arbeit ist ein Weg der Selbsterkenntnis, aber zugleich auch ein Weg der Selbstüberwindung. Je länger und intensiver man an einer Rolle arbeitet, desto eigenständiger und lebendiger wird sich der Rollencharakter in unserer Seele vergegenwärtigen und als selbstständige Persönlichkeit neben unseren Alltagsmenschen hintreten. Zwei Personen leben dann sozusagen in uns, die wir ganz klar auseinanderhalten müssen. Wenn immer sich diese zwei Personen in uns vermischen, wird das schlimme Folgen haben. Entweder kommen wir bloß wieder zur reinen Selbstdarstellung, oder, schlimmer noch, der Rollencharakter beginnt sich in unser normales alltägliches Dasein einzumischen. Man darf sich niemals mit seiner Rolle »identifizieren« wollen, auch wenn man das oft naiverweise als geradezu charakteristisch für gutes Rollenspiel annimmt. Der eigene Alltagsmensch muß stets neben und völlig getrennt vom Rollencharakter bestehen bleiben! Manchen Schauspieler, die für ihr exzessives Spiel bekannt sind, ist das nicht genügend gelungen; sie haben zwar oft großartig gespielt, aber sie sind persönlich daran zerbrochen (Musterbeispiele etwa: Romy Schneider oder Oskar Werner). Unser höheres ICH, wie es Cechov nennt, das Über-Ich im Sinne Freuds, muß sich sowohl über unsere Alltagspersönlichkeit als auch über den Rollencharakter stellen, beide streng auseinanderhalten, und jeweils frei entscheiden, wer von beiden sich gerade ausleben darf, welche sozusagen gerade den gemeinsamen Körper benutzen darf. Die Zeit, wo man noch aus dem »Bauch« heraus, aus der eigenen unmittelbaren Emotion, aus dem naturgegebenen instinktiven, aber darum auch unbewußten Talent heraus spielen konnte, ist eigentlich schon abgelaufen. "So, wie ein Maler beispielsweise außerhalb des Materials steht, das er für die Realisierung seiner Bilder benützt, stehen auch Sie, der Schauspieler, bei inspiriertem Spiel außerhalb des Leibes und außerhalb der schöpferischen Emotionen. Sie stehen über sich." (Cechov, S 122)
Was also müssen wir tun, um eine Rolle verkörpern zu können? Wir haben den Rollencharakter als eigenständige seelische Persönlichkeit in uns, neben unserer eigen, und diese selbstständige Rollenpersönlichkeit muß unseren Körper benutzen, um sich dem Publikum zu zeigen – nur ist dummerweise dieser Körper, wie könnte es auch anders sein, unserer eigenen Alltagsperson angepaßt und meist ganz und gar nicht dem Rollentypus. Folglich muß sich unser ganzer Körper ändern! Zwar wird man als kleinwüchsiger Schauspieler nicht plötzlich zum Hünen werden können, und die wenigsten werden für eine Rolle 20 kg zu- oder abnehmen wollen – aber das ist auch gar nicht nötig. Nicht, wie groß, schwer, dick oder dünn der Körper ist, gibt den Ausschlag (obwohl man darauf natürlich in gewissen Grenzen bei der Rollenbesetzung achten muß), sondern seine innere und äußere Beweglichkeit. Der Bewegungsgestalt, dem Bewegungsmuster des Körpers muß der Rollencharakter aufgeprägt werden. Wir müssen dazu unsere eigenen, von Kindesbeinen an entwickelten inneren und äußeren Bewegungsformen so vollständig als möglich überwinden und durch andere ersetzen. Die ganze Bewegungsgestalt muß vollkommen verwandelt werden. Der Begriff "Bewegungsgestalt" muß dabei denkbar weit gefaßt werden, er beginnt nämlich bereits bei der inneren Denkbewegung. Unsere Meinung, unsere Gedanken, unser Verstand, sind für den Rollencharakter völlig unwesentlich, ja störend. Das ist sogar die erste und schwerste Hürde, die wir zu überwinden haben, denn gerade durch unser Denken, mit dem wir uns ganz besonders identifizieren, klammern wir uns ganz fest an uns selbst und machen es uns sehr schwer, uns von uns selbst zu befreien. Gerade im Denken machen wir uns nur allzuleicht zum Gefangenen unserer selbst. Solange wir uns an unseren Gedanken festhalten, solange werden wir wahrscheinlich überhaupt verhindern, daß der Rollencharakter als selbstständige Persönlichkeit neben unserer eigenen aufkommen kann, und noch weniger wird es uns gelingen, diese neue, fremde Persönlichkeit unseren Körper ergreifen zu lassen. Denn der Verstand macht uns nicht nur zu Gefangenen unserer selbst, sondern er fesselt noch dazu unserer Persönlichkeit an den Kopf und verkrampft den restlichen Leib mehr oder weniger. Wer halbwegs aufmerksam beobachten kann, wird leicht bemerken, daß ausgesprochene einseitige Verstandesmenschen körperlich sehr ungeschickt, oft geradezu hölzern sind. "Bei geistiger Arbeit beobachtet man ... eine Zunahme des Energieumsatzes. Diese ist nur zum geringeren Teil durch die Mehrarbeit des Gehirns bedingt. Der größte Teil der Zunahme rührt von einer erhöhten Grundanspannung der Körpermuskulatur her." (R. Schmidt, Medizinische Biologie des Menschen, S 133) Wenn sich durch die Verstandestätigkeit die Körpermuskulatur verspannt, wird die Gestik eckig, wirkt gehemmt, oft verkrampfen sich auch die Finger und ganz besonders wird der freie Atemstrom behindert – es geschieht also alles das, was wir als Schauspieler überhaupt nicht brauchen können. Die erste, scheinbar paradoxe Grundregel der Schauspielkunst muß folglich lauten:
Der Schauspieler muß zeitweilig seinen Verstand verlieren!
Nur dann kann es uns gelingen, den Körper vollkommen zu entkrampfen und so frei beweglich zu machen, daß er sich dem Rollencharakter anpassen kann. Da wir modernen Menschen alle mehr oder weniger ausgeprägte Verstandesmenschen sind, liegt hier gerade die allergrößte Hürde für unsere künstlerische Entfaltung. Solange wir in unserem Verstand befangen bleiben, stehen wir uns selbst unweigerlich im Wege!
Die zweite Grundregel der Schauspielkunst scheint noch paradoxer zu sein:
Der Schauspieler muß zeitweilig seine Sprache verlieren.
Näher besehen, ist auch das ganz klar. In der frühen Kindheit haben wir unsere Sprache durch Nachahmung von unseren Eltern und anderen Menschen, die uns umgaben, gelernt. Unserer Sprache haften schon alleine dadurch bestimmte charakteristische Eigentümlichkeiten an. Da ist etwa das schwere
"Meidlinger" »L«, das breite "beißerische" »E« des modernen Wiener Dialekts, da sind die harten, ganz im Rachen steckenden Konsonanten des Tirolerischen, die weichen, vokalischen Laute im Kärtnerischen, das knappe und abgehakte Berlinerische, das charakteristische »R« der Bayern usw. Dazu kommt unsere eigenes Grundtemperament, das für einen bewegteren oder müderen, für einen klareren oder verschwommeneren Redefluß sorgt. Hinzu kommt – wieder einmal – unser Verstand, der uns dazu drängt, durch die Sprache vorwiegend Gedanken vermitteln zu wollen. Viele scheinen ja heute überhaupt zu glauben, daß das der einzige Zweck des Sprechens ist: Gedanken, oder, noch schlimmer, abstrakte »Informationen« zu transportieren. Der Verstand macht die Sprache monoton, zergliedert sie in einzelne Phrasen, in Sätze und Absätze, an denen der lebendige Redefluß zerbricht – man beachte nur, wie sehr wir dazu neigen, die Sprache am Ende eines Satzes, oft sogar schon am Ende einer Verszeile auf den Punkt hin zu senken. Das Sprechtempo variiert ebensowenig wie die Tonhöhe; höchstens werden noch einige Begriffe, die wir für wichtig erachten, besonders betont. Was wir derart von uns geben, mag durchaus sehr gescheit sein, aber es ist zugleich für das Publikum fürchterlich langweilig und anstrengend zu verfolgen und wird bei den Zuhören genau das bewirken, was auch meist bei faden Vorträgen geschieht: das Publikum wird sanft entschlummern! Die Sprache sinkt dadurch zum bloßen Diener des Verstandes herab, der in Wahrheit, so wie er sich heute darstellt, nur ein kümmerliches Destillat der viel größeren Weisheit ist, die in der Sprache selbst lebt. Tatsächlich hat ja Aristoteles, der Begründer des logischen Verstandesdenkens, die Logik der Sprache abgerungen. »Logos« heißt bekanntlich im Griechischen »Wort«, und die Logik ist nichts anderes als eine Beschreibung des grammatikalischen Satzbaues und der geordneten Satzfolge, die die Menschheit schon lange beherrschte, ehe sie sich des abstrakten Verstandes bewußt geworden ist. Und die »Kategorienlehre« des Aristoteles, die Mutter aller schematischen Verstandeseinteilungen, spiegelt nichts anderes wieder als die zehn verschiedenen Wortarten (Substantiv, Verbum usw.) der griechischen Sprache. Damit ist nichts gegen den Verstand gesagt, den wir natürlich als moderne Menschen unbedingt brauchen, und der uns auch einen Teil der in der Sprache für uns zunächst unbewußt waltenden Gesetzmäßigkeiten bewußt und dadurch frei verfügbar gemacht hat, aber als Künstler brauchen wir mehr. Wir müssen die volle Weisheit der Sprache ausschöpfen – und die überragt unseren winzigen Verstand beiweiten. Kein Mensch hätte die Sprache bewußt mit seinem Verstand »konstruieren« können, wir haben vielmehr alle unseren Verstand der Sprache abgelauscht. Darum lernt ja auch das Kind zuerst sprechen und dann erst denken! Für den Schauspieler gilt jedenfalls ganz unbedingt: wir sollen nicht versuchen, die Sprache durch unseren Verstand zu belehren, sondern wir müssen von der Sprache selbst belehrt werden. Das wirkt, nebenbei bemerkt, wenn man es nur genügend bewußt erlebt, recht förderlich und kräftigend auf den eigenen Verstand zurück. Man wird bald bemerken können, daß die fortgesetzte intensive Arbeit mit der Sprache unser Denken treffsicherer und entschlossener macht. Es geht uns dann nicht mehr so leicht wie Shakespeares Hamlet, der feststellen muß: "der angebornen Farbe der Entschließung wird des Gedankens Blässe angekränkelt; und Unternehmungen voll Mark und Nachdruck, durch diese Rücksicht aus der Bahn gelenkt, verlieren so der Handlung Namen." (Hamlet III/1) In Griechenland, der Wiege des philosophischen, ja überhaupt des abendländischen Denkens, hat man daher stets das philosophische Gespräch gepflegt, und man hat sich seine wesentlichsten Gedanken nicht einfach alleine daheim im stillen Kämmerchen gemacht. Platon hat deshalb sogar seine philosophischen Schriften in Dialogform verfaßt, und Aristoteles führt immerhin noch ein fiktives Gespräch mit seinem Leser. Dabei muß man sich auch gleich darüber klar sein, wie man in griechischer Zeit bis hinein in die ersten nachchristlichen Jahrhunderte gelesen hat: man hat nämlich niemals den Text bloß leise lesend gedanklich aufgenommen, sondern man hat ihn überhaupt nur laut rezitierend erfaßt.
Augustinus, der frühchristliche Kirchenvater des 4. Jahrhunderts, berichtet
noch als ein Schüler des Bischofs Ambrosius ganz erstaunt, daß er diesen stumm
lesend an seinem Pult angetroffen habe, und er rätselte darüber, wie denn das
überhaupt möglich wäre! (Augustinus, Bekenntnisse, VI/3) Übrigens, weil gerade das Wort »Pult« gefallen ist: man hat in dieser Zeit auch niemals sitzend gelesen, sondern immer nur stehend, und man hat auch seine Gedanken niemals sitzend entwickelt, sondern stehend oder, noch häufiger, gehend. Deswegen hießen auch die Schüler des Aristoteles »Peripatetiker«, die »Herumwandelnden«. Der griechische Verstand entwickelte sich eben nicht nur aus der Sprache, sondern überhaupt aus der ganzen lebendigen Körperbewegung, und er war daher auch ganz anders als unser modernes Denken, das sich ganz im Kopf konzentriert und den restlichen Körper weitgehend ablähmt. Aristoteles hat noch ganz selbstverständlich angenommen, daß das zentrale Organ des Denkens das menschliche Herz sei, womit er für seine Zeit durchaus recht hatte, während dem Gehirn lediglich die Funktion eines raffinierten »Blutkühlers« zukomme - was übrigens tatsächlich eine der phantastischsten Leistungen des Gehirns ist: das Gehirn verbraucht nämlich selbst im Schlaf beinahe ein Viertel unserer ganzen Stoffwechselenergie alleine um seine komplexe Struktur, die beständig abzusterben droht, aufrecht zu erhalten; die dabei unvermeidlich auftretende überschüssige Wärme muß sehr effektiv abgeleitet werden. Unser modernes Verstandesdenken bedient sich allerdings tatsächlich fast ausschließlich des Gehirns als Denkwerkzeug – und gerade darum ist der Verstand dem Schauspieler im Wege! Er solle ja seine Rolle nicht
»verhirnen« oder »verkopfen«, sondern verkörpern.
Inspiriertes Spiel ist mit unserer Alltagssprache nicht möglich, dazu ist sie zu sehr durch unsere Persönlichkeit korrumpiert. Unsere Sprache müssen wir also loswerden, um später eine neue gewinnen zu können. Natürlich müssen wir nicht gleich unsere ganze Muttersprache verlieren und stumm wie die Fische werden, aber unsere Sprechgewohnheiten, durch die wir unsere Muttersprache zum Spiegelbild unserer Persönlichkeit machen, müssen wir ablegen. Wir müssen, aber mit dem voll wachen Bewußtsein des Erwachsenen, wieder in jene Phase der Kindheit zurückkehren, in der wir ganz spielerisch unsere Sprache erlernt haben. Wir müssen wieder lernen, spielerisch mit den Lauten umzugehen, und die Freude am Spiel muß unsere Übungen leiten. "Denn, um es endlich auf einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Dieser Satz, der in diesem Augenblicke vielleicht paradox erscheint, wird eine große und tiefe Bedeutung erhalten, wenn wir erst dahin gekommen sein werden, ihn auf den doppelten Ernst der Pflicht und des Schicksals anzuwenden; er wird, ich verspreche es Ihnen, das ganze Gebäude der ästhetischen Kunst und der noch schwierigern Lebenskunst tragen."
(F. Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen)
Wir müssen unsere ganze einseitig verhärtete Alltagssprache zu einer lebendig beweglichen Lautwelt aufschmelzen, aus der die Worte neu geboren werden. Kein Begriff darf uns dabei hindern; wir müssen »vergessen«, was die Worte bedeuten, d.h., worauf sie bloß hindeuten, und sollen sie selbst unmittelbar in ihrem Werden erleben. In allen nachfolgenden Sprachübungen geht es primär um dieses reine Laut- und Worterlebnis, um die reine Sprache, um die vom Begriff befreite Sprache. Das Kind lernt ja normalerweise auch erst zu sprechen und dann zu denken. Es wendet die ersten einsilbigen Worte, die es sich mühsam bildet, auf alles mögliche passende und unpassende an und kümmert sich nicht im geringsten darum, was sie bedeuten. Es hat einfach eine himmlische Freude daran, sich zu artikulieren; es musiziert und plastiziert mit den Lauten in einem ganz natürlichen Spiel und versucht die Wortgebilde nachzubilden, die ihm seine Umgebung zuträgt. Das kleine Kind ist ein wahrer Meister der völlig naiven Nachahmung – der Künstler muß sich etwas von dieser Fähigkeit für das spätere Leben bewahren – dann ist er ein Naturtalent – oder er muß sie, weil sie durch unser modernes Leben verschüttet wurde, mühsam aus der Tiefe seines Wesens wiedergewinnen. Dort schlummert sie nämlich ganz sicher; unsere Übungen sollen helfen, dahin vorzudringen.
Gelingt das, dann schöpfen wir unmittelbar aus dem Urquell der menschlichen Sprache und wir werden jedes einzelne Wort, jede Silbe, ja jeden einzelnen Laut – das sei ganz ohne Übertreibung gesagt – wie ein ganz unglaubliches Wunder erleben, das sich erstmals vor unserem Bewußtsein entfaltet. Das unterscheidet uns nämlich doch von den Kindern, daß diese die Sprache schlafwandlerisch, beinahe unbewußt erlernen, während wir als Künstler diesen Prozeß voll bewußt erleben können. Dann geht aber eine völlig neue Welt, die uns immer wieder neue Überraschungen bringt, vor unserem Bewußtsein auf. Eine Welt, die dem Alltagsmenschen so unbekannt ist, daß er nicht einmal vage ahnt, daß sie existiert. Dieses Erlebnis, das man an der Sprache haben kann, und als Künstler auch haben sollte, ist mindestens so dramatisch und aufregend, wie wenn ein Blindgeborener nach einer erfolgreichen Operation erstmals die Farbenwelt erlebt! Tatsächlich sind wir als Alltagsmenschen blind für die verborgene Lichtwelt der sprachbildenden Kräfte. Ich gebrauche die Lichtmetapher ganz bewußt, denn man hört dann nicht mehr allein die Worte, man sieht sie rein seelisch in ihrer Form- und Farbenvielfalt. Wir sprechen ja auch so von hellen oder dunklen, harten oder weichen Lauten und denken uns nicht viel dabei. Für den Sprachkünstler wird das und mehr zum ganz realen seelischen Erlebnis. Ganz besonders wird jedes Wort, jeder Laut, ganz besonders jeder Vokal von einem ganzen Schwall von Gefühlen begleitet werden, die aber nun nicht mehr unsere persönlichen Gefühle sind, sondern aus denen eine gleichsam objektive Gefühlswelt spricht, die mit den tieferen Schichten der Sprache untrennbar verbunden ist und von der unsere persönlichen Gefühle nur ein matter einseitiger Abglanz sind. Diese objektive Gefühlswelt steht uns aber dann auch für die Rollengestaltung zur Verfügung, und aus ihr dürfen wir ungehemmt schöpfen – oder besser gesagt: der Rollencharakter, der in uns lebt, wird selbsttätig das daraus entnehmen, was ihm angemessen ist. Wir müssen uns überhaupt nicht überlegen, wie wir die Rolle sprechen sollen, sie sorgt schon selbst dafür, wenn wir nur zäh genug unsere Übungen machen. Die gehören nämlich für den Schauspieler ebenso zum täglichen Leben wie für den Klavierspieler seine Fingerübungen. Lassen wir uns doch einfach davon überraschen, wie unser Rollencharakter allmählich selbstständig sprechen lernt! Seien wir einfach wachsamer, aber stiller Zuschauer dessen, was sich in uns entfaltet – wir haben dazu zweifellos den besten Logenplatz! Natürlich gehört Mut dazu; man muß einfach fest darauf vertrauen, daß das Nötige entstehen wird – dann wird es auch entstehen. Man sollte die Schöpferkraft der Sprache nicht unterschätzen; sie wird alles viel besser zustande bringen als wir es uns jemals ausdenken könnten.
Nur so kann man zu einem wirklich inspirierten Spiel kommen. Und den Ausdruck »inspiriert« darf man dabei ganz wörtlich nehmen: "Inspiration" heißt "Einatmung" – und das richtige Atmen ist die Grundvoraussetzung der künstlerischen Sprache. Die Atmung öffnet den Körper derart, daß er zum tauglichen Werkzeug des künstlerischen Erlebens und Gestaltens werden kann. Die richtige Atmung führt uns vom bloßen Kopfbewußtsein zu einem leisen Körperbewußtsein hin, das für den Schauspieler ganz wesentlich ist. Der abstrakte Verstand hingegen hemmt den harmonischen Atemstrom und fesselt unser Bewußtsein in der Kopfregion, an der der Körper, kraß gesprochen, wie ein hölzerner Klotz hängt. Wer nur aufmerksam genug ist, kann erleben, wie jeder einzelne abstrakte Begriff, den er sich bildet, ganz leise den Atemrhythmus und weiter sogar den Bewegungsrhythmus der Gliedmaßen hemmt. Das liegt an der schon angesprochenen Muskelverkrampfung, die mit jeder rein intellektuellen Tätigkeit notwendig verbunden ist. Wir können uns nämlich überhaupt nur dadurch scharf umgrenzte abstrakte Begriffe bilden, daß der Kopf, das Denkwerkzeug, so weit als nur irgend möglich ruhig gestellt wird. Und das geschieht eben dadurch, daß sich der Körper zum steifen Gerüst verfestigt, dessen einzige Aufgabe darin besteht, den Kopf ruhig zu tragen. Nur dadurch wird unser Seelenleben so unbeweglich, daß es in einzelne streng von einander gesonderte abgegrenzte starre Begriffe zerfällt, die wie tote Gegenstände frei miteinander kombiniert und in eine unverrückbare logische Folge gebracht werden können. Inhaltlich umfassen diese Begriffe nur das, was wir ihnen durch strenge Definition zugestehen, und innerhalb dieser definierten Grenze werden sie festgehalten und dürfen sich selbsttätig nicht weiterentwickeln. Der abstrakte Verstand zerschneidet die Welt, indem er zugleich alle Sinnesqualitäten, alle Gefühle usw. aussondert, in einzelne Teile, aus denen er sich anschließend wie bei einem Puzzlespiel ein abstraktes, von allen Wahrnehmungsqualitäten befreites Abbild der Welt rekonstruiert. Wesentliche daran ist, daß dieses Bild einzig und allein durch unsere eigene bewußte Verstandestätigkeit zustande kommt, und alle Kräfte, die aus dem Unbewußten aufsteigen könnten, streng ausgeschieden werden. Wir haben es dann nur mit unserer eigenen vollbewußten geistigen Tätigkeit zu tun: gerade das hat aber unser Persönlichkeitsbewußtsein extrem gesteigert. Der Grieche hat, wie wir gesehen haben, noch nicht so gedacht – und eben darum hat er sich auch noch nicht so sehr als einzelne auf sich gestellte Persönlichkeit empfunden wie der heutige Mensch. Er fühlte sich noch vielmehr als Mitglied einer sozialen Gemeinschaft, der Polis, denn als einzelner Mensch. Ein gewisses kollektives Erleben, wie es die Menschheit früherer Jahrtausend überhaupt gekennzeichnet hat, war ihm noch eigen, aber er spürte immerhin schon sehr stark in sich das Verlangen, eine eigenständige Persönlichkeit zu werden, was immerhin dann bei den Römern schon viel stärker gelang, aber erst wirklich in der späteren Neuzeit so richtig zum Durchbruch kam. Wir sehen also, was wir durch den Verstand gewonnen haben: das Bewußtsein, eine eigene Persönlichkeit zu sein, die allein auf sich selbst gestellt, frei für sich entscheiden kann. Darum konnte der französische Philosoph René Descartes begeistert ausrufen: "Ich denke, also bin ich." Hier liegt auch die Wurzel aller modernen Demokratiebestrebungen: das Volk soll zu einer Versammlung freier Persönlichkeiten werden, die gemeinsam die Zukunft gemäß ihren persönlichen Wünschen, die sie miteinander absprechen, gestalten wollen. Die griechische Demokratie hat zwar unsere moderne vorbereitet, unterscheidet sich aber doch noch wesentlich von ihr – man denke nur, mit welcher Selbstverständlichkeit sich der Grieche seine Sklaven hielt, die, selbst wenn er sie gut behandelte, doch völlig rechtlos waren. Erst der eng mit der lateinischen Sprache verbundene römische Verstand hat ein Rechtssystem geschaffen, das mit der einzelnen Persönlichkeit, mit dem einzelnen Bürger rechnet, und dieses römische Rechtssystem wirkt über den Umweg über das römisch-katholische Kirchenrecht bis in unsere moderne Staatsgrundlage nach.
Der Verstand macht den Menschen erst zur bewußt eigenständigen Persönlichkeit. Man kann das Wort "Verstand" geradezu so auffassen, daß dadurch der Mensch gelernt hat, fest auf sich selbst zu stehen – und das begründet zugleich den persönlichen Egoismus, und er beginnt gerade im römischen Kulturkreis. Vorher gab es ihn in dieser Art kaum, sondern nur einen überpersönlichen Egoismus, der seine Wurzeln im kollektiven Erleben der Menschen hatte. Was irgend einem Mitglied des Kollektivs angetan wurde, das verspürte man unmittelbar so als wäre es einem selbst geschehen, so wie wir es heute ziemlich gleich schlimm empfinden, wenn uns jemand ins Gesicht oder in den Magen schlägt. Die Schuld oder Unschuld des einzelnen Menschen kam dabei überhaupt nicht in Betracht. Was eine Familie der anderen antat, das mußte an der anderen Familie gerächt werden, egal wen es dort traf. Darin gründet sich das Prinzip der Blutrache, das da und dort bis in die heutige Zeit nachwirkt (man denke nur an die Bedeutung der "Familie" in den mafiosen Vereinigungen). Das gilt ganz besonders auch noch für die frühgriechische Zeit, in der sich der einzelne Mensch vorwiegend als Glied der Familie, des Stammes oder Volkes empfand. Man empfand das Kollektiv als eine Art Überpersönlichkeit; und der Stammesführer, der König, war der, der am besten artikulieren und durchsetzen konnte, was in diesem kollektiven Bewußtsein an Bedürfnissen lebte, und was das Kollektiv an Taten setzte, war eben der Wille dieser kollektiven Überpersönlichkeit – darin liegt eine der Wurzeln der griechischen Götteranschauung: Was man auch tat, ob man Kriege gegen andere Stämme oder Völker führte, ob man Rache nahm – man tat es in göttlichem Auftrag; das wird noch in den homerischen Epen sehr deutlich und beginnt erst in der klassischen Zeit allmählich zurückzutreten. Immerhin empfanden noch die Athener die Göttin Athene ganz selbstverständlich als ihre Stadtgöttin. Ursprünglich gründen alle diese Kollektive in der Blutsverwandtschaft. Etwas davon wirkt noch nach, wenn eine Mutter das Leid, das einem ihrer Kinder zugefügt wird, unmittelbar wie ihr eigenes verspürt. Je mehr die Stämme zu Völkern zusammenwuchsen, desto mehr trat die reine Blutsbindung zurück; was jetzt das Kollektiv vorallem verband, war die gemeinsame Sprache. Sprache ist ja immer überpersönlich, eine reine Privatsprache des einzelnen kann es nicht geben. Auch über einzelne Völker hinausragende religiöse Gemeinschaften sind ganz wesentlich von einer gemeinsamen Sprache bestimmt – man denke nur, was die Lateinische Sprache für die katholische Kirche bedeutet hat oder das Arabische noch heute für den Islam. Diese religiösen Gemeinschaften stellen auch ganz deutlich das Kollektiv über die Einzelpersönlichkeit, die letztlich als ihr dienendes Glied aufgefaßt wird. Und Luther hat gerade dadurch am wirksamsten gegen diesen kollektivistischen Katholizismus protestiert, daß er die Bibel ins Deutsche übersetzte.
Das zu bedenken, kann dem Schauspieler hilfreich sein, der sich durch seine Rolle ins griechische Zeitalter zurückversetzen muß. Er muß sich dann in eine Zeit einleben, in der die Sprache noch wenig vom Intellekt beeinflußt, aber dafür umso mehr vom Gefühl getragen ist. Er muß den Schritt vom intellectus zum pathos finden, d.h. zum ehrlich erlebten Gefühl, das aber niemals gemacht erscheinen darf, weil es sonst zum falschen Pathos wird, das den Zuseher zurecht abstößt. Gemacht wirkt es immer, wenn wir verstandesmäßig nach dem Inhalt des Textes entscheiden, daß nun ein bestimmtes Gefühl angebracht wäre und dann so tun als ob wir es auch hätten – dann ist es geheucheltes Gefühl. Das echte Gefühl wird von selbst entstehen, wenn wir nur die Sprache stark genug aus dem lebendigen Atemstrom empfinden. Dann lassen die Laute aus ihrem wechselnden Rhythmus heraus von selbst das ihnen entsprechende Gefühl entstehen. Es steigt dann so in uns auf, daß wir selbst davon überrascht werden – und dann wirkt es auch, weil es wirklich spontan erlebt ist. Auch im alltäglichen Leben fassen wir ja nicht zuerst den Entschluß etwa traurig zu sein, und bemühen uns anschließend diese Stimmung aus uns herauszuholen, sondern das Gefühl entsteht von selbst und wir müssen es zur Kenntnis nehmen – auch dann, wenn es uns vielleicht gar nicht angenehm ist. Schmerzliche Gefühle würden wir dann wohl kaum in uns erregen. Das unterscheidet eben das Gefühlsleben wesentlich von unserer Verstandestätigkeit, daß wir unsere abstrakte Begriffsbildung vollkommen selbst beherrschen, die Gefühle aber nicht in gleichem Maße. Gefühle müssen wir zunächst so nehmen wie sie kommen, aber der Verstand kann uns helfen, nicht von ihnen überrollt zu werden. Die Sprache kann uns als Schauspieler helfen echte Gefühle in uns entstehen zu lassen, weil die Sprache letztlich nichts anderes ist als gestalteter Atem, und weil andererseits die Atmungsorgane wiederum das unmittelbare körperliche Werkzeug des Gefühlslebens sind. Man kann ja leicht bemerken, das jede Veränderung oder Beeinträchtigung der Atmung sofort starke Gefühle auslöst. Atembeklemmung etwa ist unmittelbar mit einem starken Angstgefühl verbunden, umgekehrt regt ein seelisches Hochgefühl sofort den Atem und auch den Pulsschlag an. Unser rhythmisches System, also vorallem die Atmungs- und Kreislauforgane, sind rein körperlich das Zentrum des Gefühlslebens, ebenso wie das Gehirn das Zentrum des abstrakten Denkens ist. Jeder Vokal, der in unserer Sprache erklingt, löst ganz leise eine bestimmte Stimmung aus, und jeder Konsonant modifiziert sie auf charakteristische Weise. Wenn man die Melodie, den Rhythmus und die Harmonien der einander folgenden Laute erfaßt und dabei ganz von der Wortbedeutung absieht, dann beginnt man die Sprache als Musik zu erleben. In dieser in der Sprache verborgenen Musik lebt sich aber unmittelbar das Gefühl aus. Genau das haben die großen Komponisten gespürt, wenn sie Gedichte vertont haben. Die Wortbedeutung war ihnen unwesentlich, Begriffe kann ja die Musik nicht vermitteln, aber das dahinterstehende Gewoge der Gefühle wollten sie durch ihre Musik
offenlegen. In der Musik offenbart sich eben unmittelbar, was in der Sprache nur verborgen ruht. Damit der Sprachkünstler die Musik der Sprache erleben kann, dazu muß er zwar kein Musiker sein, aber er muß die Sprache so lebendig gestalten, daß sie in den wechselnden Tonhöhen und Tempi tatsächlich in Gefühlstönen zu klingen beginnt. Düstere dunkle Laute, die man bis tief in den Unterleib hinein spürt; helle Vokale, die in den Schädelknochen widerklingen; das Stakkato harter Konsonanten, die blitzschnell aufeinander folgen – all das entrollt vor unserer Seele ein ganzes Gefühlsdrama, das sich hinter dem begrifflichen Inhalt des Textes verbirgt, und durch das wir unmittelbar ins Seeleninnerste des Rollencharakters blicken und ihn zugleich dem Publikum fühlbar machen. Im Alltagsleben können wir nicht ins Innerste unserer Mitmenschen schauen – im Rollencharakter stehen wir
mittendrinnen: und wenn wir nur stark genug die Sprache in uns wirken lassen, so daß sie zur Musik wird, dann kann auch das Publikum an diesem Erlebnis teilnehmen. Wir erreichen dann das Publikum nicht nur auf der Verstandesebene, sondern wir machen die, die uns zusehen, zu echten Mitfühlenden.
Und noch ein Drittes ist nötig: auch der Wille muß sich unmittelbar dem Publikum gegenüber aussprechen. Der Wille lebt in allem, was wir tun. Er zeigt sich in der kleinsten Fingerbewegung, in der Gestik unserer Arme, in einem flüchtigen Blick, in der Art wie wir gehen, etwa darin, ob wir fest mit der Ferse auftreten oder leichtfüßig über den Boden huschen. Überhaupt zeigt sich die Willenscharakteristik unserer Persönlichkeit in der ganzen Körperhaltung. Ob wir aufrecht stehen oder mit leicht gekrümmtem Rücken, ob wir häufig leise den Kopf senken oder ihn häufig zurückwerfen, ob unsere Schultern eingesunken sind oder wir mit leichtem Hohlkreuz durch die Welt marschieren – all das gibt ein lebendiges Bild unserer Persönlichkeit, das für den, der es zu lesen vermag, viel mehr aussagt als das, was wir an Meinungen und Gedanken äußern. In der Körperhaltung zeigt sich nämlich unmittelbar unser Können, nicht unser Wissen, unsere Fähigkeit, wirklich etwas zu tun – denn der Gedanke allein, sei er auch noch so klug, vollbringt noch nichts. Der Wille ist es, der ihn zur Tat werden läßt. Der Wille bestimmt, ob wir auch unser Wissen in Taten umsetzen können – und dieser Wille spricht sich in unserer ganzen Gestalt aus. Sie ist ein Spiegelbild der verborgensten Seiten unserer Persönlichkeit: unserer Persönlichkeit, wohlgemerkt – und die wollen wir ja gerade nicht auf der Bühne darstellen, sondern eine ganz andere, nämlich den Rollencharakter. Darauf haben wir ja schon hingewiesen: Wir müssen unsere natürliche Bewegungsgestalt aufgeben, überwinden, und dafür eine neue gewinnen. Daher gilt als dritte Grundregel der Schauspielkunst:
Der Schauspieler muß zeitweilig seine ganze bewegte Gestalt verlieren.
Alle Übungen zum Rollenspiel, namentlich auch die Temperamentsübungen sollen dahin führen, daß unsere ganze Gestalt so beweglich wird, daß wir uns so weit als nur möglich von unseren Bewegungsgewohnheiten und von unserer natürlichen Körperhaltung befreien, so daß dadurch Raum geschaffen wird für den Rollencharakter, der sich verkörpern will. Jede kleinste Geste, durch die unsere Persönlichkeit durchleuchtet, stört den Bühnencharakter. Hier müssen wir ganz frei von uns selbst werden. Und hier ist es zugleich auch am
allerschwersten, denn wie wir gehen, wie wir unsere Gesten machen, wie wir schauen, dessen sind wir uns am allerwenigsten bewußt. Zwar zeigt sich gerade in unserer bewegten Gestalt unsere Individualität am aller deutlichsten – nur nicht für uns selbst. Denn alle anderen können uns von außen bei unseren Bewegungen zusehen und mit verständigem Blick daraus sehr viel ablesen – nur just wir selbst können uns von außen nicht anschauen. Da hilft im Grunde auch kein Spiegel, denn den können wir nicht beständig mit uns herumführen, und außerdem verändert der beständige Blick in den Spiegel unser ganzes Tun so stark, daß sich daraus wieder nichts vernünftiges ergibt. Auch Video und Film können uns nicht wirklich helfen, weil sie uns erstens kein reales räumliches Erleben vermitteln – und gerade auf die Bewegungsformen im Raum kommt es an – und weil sie uns nur einen stark verzerrten Eindruck liefern, indem sie manche Details kraß überbetonen und andere wiederum stark unterdrücken. Das einzige, was wirklich helfen kann, ist, daß wir unser Bewußtsein für die Feinheiten unserer Körperbewegungen erwecken und sie dadurch gleichsam von innen her objektiv erleben können. Dazu sollen unsere Übungen dienen. Und wenn wir uns derart unserer Körpersprache, die eigentlich eine Seelensprache ist, bewußt werden, dann wird das auch das beste Mittel sein, daß wir unsere persönlichen Eigenheiten loswerden, denn eines wird man bald bemerken: wenn man das, was man sonst unbewußt tut, plötzlich ganz bewußt ausführen soll, dann funktioniert auf einmal gar nichts mehr! Unsere ganze Gestik, unsere ganze Körperhaltung wird vollkommen durcheinander kommen – und das ist gut so; nicht als endgültiges Ziel unserer Übungen, aber als notwendiges Durchgangsstadium! Ähnliches wird man übrigens auch schon bei den Sprachübungen bemerken. Auch da kommt normalerweise eine Phase, wo man mit der Sprache nicht mehr zurecht kommt, wo man plötzlich über Worte stolpert, die einem vorher keine Mühe bereitet haben. Das zeigt, daß man die Übungen richtig gemacht hat und daß sie nun zu wirken beginnen und unsere Sprache bald fähig sein wird, sich wirklich zu verwandeln. Ganz ähnlich ist es mit unserer Körpersprache. Ein bißchen davon merkt man ja schon, wenn man zum aller ersten Mal auf der Bühne steht. Dann wirken meist schon die einfachsten Schritte und Handbewegungen recht unbeholfen. Ganz instinktiv will man sich nämlich nicht vor aller Augen zur Schau stellen, man will eigentlich unbewußt seine Bewegungsgewohnheiten verstecken, sie zeitweilig loswerden; jede Bewegung wirkt gehemmt und zurückhaltend, weil zugleich auch noch nicht zu einer neuen Bewegungsform hinfindet. Das, was sich natürlicherweise ankündigt, muß ganz einfach durch die Übungen verstärkt und weitergeführt werden. Und wenn wir dann uns selbst losgeworden sind, und wenn wir dann endlich genügend beweglich geworden sind, dann kann sich der Rollencharakter wirklich unseres Körpers bemächtigen und sich selbst verkörpern. Wie er sich schließlich verkörpern wird, dazu brauchen wir gar nichts mehr tun, davon dürfen wir uns getrost überraschen lassen. Damit haben wir eigentlich das Ziel aller Schauspielkunst erreicht: wir haben eine Rolle glaubhaft verkörpert.
Mehr als unserer drei Grundregeln bedarf es dazu nicht, aber wir leisten damit zugleich das schwierigste, was man als Mensch überhaupt leisten kann: Selbstüberwindung. Das wird uns wohl niemals vollkommen gelingen, aber jeder Schritt in diese Richtung bringt uns weiter. Wir kehren gewissermaßen mit einem Teil unseres Wesens in den Embryonalzustand zurück und lassen daraus einen neuen zweiten Menschen in uns heranwachsen. Wir gehen schwanger mit der Rolle, und der erlernte Rollentext und unsere beständigen Übungen sind die Nahrung, die den Rollencharakter wachsen und reifen läßt, bis er eigenständig gehen, sprechen und denken lernt. Und in dem Maße, in dem wir uns für die Rolle derart selbst überwinden, gewinnen wir uns zugleich selbst ein bißchen reifer zurück.
Und solang du das nicht hast,
Dieses: Stirb und werde!
Bist du nur ein trüber Gast
Auf der dunklen Erde.
J. W. Goethe
VOKALÜBUNGEN
In den Vokalen erklingen musikalische innere Seelenstimmungen; in ihnen drückt sich unmittelbar das Gefühl aus. Indem man eine bestimmte Vokalstimmung über ein Wort, einen Satz oder über eine ganze Strophe ausgießt, erhält sie ein charakteristisches gefühlsmäßiges Kolorit. Im Vokalklang wird der Atem gehalten; der Körper dient als Resonanzkasten à helle Vokale = Kopfresonanz, dunkle Vokale = Rumpfresonanz. Niemals darf die Lautstärke durch Kraft mit den Stimmbändern erzeugt werden. Die Vokalklänge und die damit verbundenen Stimmungen müssen ebenso deutlich und bewußt voneinander unterschieden werden, wie es uns für die 7 Regenbogenfarben und ihre vielfältigen Nuancen selbstverständlich ist.
Das A sitzt physiologisch ganz weit hinten im Rachen; seelisch aber verbinden wir uns gerade durch das A ganz naiv staunend mit der Welt draußen und vergessen auf uns selbst. Im A erlebt man die ganze Welt beseelt. Das U hingegen sitzt physiologisch ganz weit vorne, seelisch aber ziehen wir uns ganz in uns selbst zurück, während wir die Welt als völlig seelenlos empfinden. Das O sitzt inmitten zwischen A und U und bedeutet für unser Erleben, daß wir seelisch weder ganz in der Außenwelt ertrinken noch auch uns ganz in uns selbst zurückziehen, sondern durch bewußtes teilnehmendes Interesse Inneres und Äußeres aktiv miteinander verbinden.
Physische und seelische Lautbewegung sind genau gegensätzlich!
"Das wahre schöpferische Fühlen liegt nicht an der Oberfläche der Seele. Aufgerufen aus den Tiefen des Unterbewußtseins, versetzt es nicht nur den Zuschauer, sondern auch den Schauspieler selbst in Erstaunen."
M. Cechov, S 39
Grundstimmungen der Vokale
A
bedeutet, sich zu öffnen, zu staunen, zu fragen, auch zu zagen. Man will etwas von außen empfangen. Der Mund muß sich weit und lang nach unten öffnen, ohne sich aber dabei zu verkrampfen; im Gegenteil werden gerade im A alle inneren Verspannungen aufgelöst. A wird ganz weit hinten im Rachen gebildet, seelisch führt es aber von einem selbst weg hinaus in die Welt. Die Resonanz erfolgt vorwiegend im oberen Bereich des Rumpfes. Fragende Geste.
E
hält an sich, versperrt sich vor der Welt und besinnt sich auf sich selbst. E kann sehr schneidend werden: dann zerteilt, zersplittert es oder analysiert mit kritischem Verstand. Der Mund wird breit und öffnet sich nur wenig; eventuell werden die Zähne gefletscht. Normalerweise ergibt sich helle Kopfresonanz. Ansichhaltende Geste.
I
hat etwas zielstrebiges, bestimmt hinweisendes an sich. Es wendet sich extrovertiert nach außen. Die ganze Gestalt will sich im I strecken, straffen. Helle Kopfresonanz. Hinweisende Geste.
O
zeichnet sich durch seinen warmen vollen Klang aus, der Sympathie verströmt. Man möchte sich freudig mit der Welt vereinen. Der Mund muß sich schön runden. Das O erklingt inmitten der Brust. Sympathiegeste.
U
hat einen kühlen und harten Klang und deutet oft auf etwas Unangenehmes hin, das man abwehren möchte. Es kann aber auch gelegentlich ein lustvolles Empfinden bedeuten, das aus der Tiefe aufsteigt. Es wird ganz vorne mit vorgespitzten Lippen gebildet, seelisch zieht man sich allerdings gerade vor der Außenwelt zurück. Die Resonanz erfolgt tief unten im Rumpf. Abwehrende Geste.
EI bedeutet die Verschmelzung der hellen Vokale und kann als weiches Streicheln, aber auch als heller Glanz empfunden werden. Es dringt, schon bedingt durch seine weitgehende Kopfresonanz, kaum in die Tiefe, sondern streicht gleichsam über die Oberfläche. Man nimmt alles leicht und oberflächlich.
AU
verbindet die dunklen Vokale (eigentlich A-O-U, wenn man deutlich spricht) miteinander und dringt durch und durch. Das kann schmerzvoll empfunden werden, bedeutet jedenfalls eine den ganzen Raum erfüllende seelische Präsenz. Man nimmt alles schwer und ernst.
KONSONANTENÜBUNGEN
Die Konsonanten bilden äußere Formbildekräfte nach. Je stärker sie gestaltet werden, desto mehr Atemluft verbrauchen sie – desto stärker ist aber auch ihre künstlerisch gestaltende Wirkung. An der Gestaltung der Konsonanten wirken weniger die Stimmbänder mit ( die erregen den Vokalklang), als vielmehr der ganze Rachenraum, mit Gaumen, Zunge, Zähnen, Ober und Unterkiefer usw. Elastische Beweglichkeit in diesen Organen ist für gut gestaltete Sprache unerläßlich. In den Konsonanten lebt sich der gestaltende Wille unmittelbar aus. So wie wir Würfel, Kugeln, Zylinder usw. deutlich auseinanderhalten können, so müssen auch die Formkräfte der Konsonanten klar voneinander unterschieden werden. Die Konsonanten müssen so stark erlebt werden, als könnte man sie buchstäblich mit Händen tasten. Im Gegensatz zu den äußeren Gegenständen sind sie keine festen, fertigen Formen, sondern tätig werdende Bewegungsformen, die unmittelbar mit unseren Händen gespürt werden müssen.
Physiologischer Sitz der Konsonanten
|
Lippenlaute |
B, P, M, W, R |
Brummweib |
Begreifen |
|
Zahnlaute |
F, V, S, SCH, Z, C |
Fußschutz |
|
|
Zungenlaute |
N, D, T, L, R |
Neandertaler |
Gefühl |
|
Gaumenlaute |
G, K, CH, Ng, H, R |
Kirchgang |
Wille |
Bergbewohner bevorzugen Gaumen- und Kehllaute (Tiroler!); Flachlandbewohner (Wien, NÖ,
Bgl) bevorzugen Lippenlaute. Seefahrer bevorzugen Zungenlaute (im lebendigen Gefühl bildet sich das lebendig bewegte Wasser ab).
Gebildete Menschen bevorzugen Konsonanten, weil sich in ihnen das Begreifen, der zielgerichtete Wille, aber auch das kultivierte Gefühl ausdrückt.
Ungebildete Menschen sind mehr emotional orientiert; sie bevorzugen daher die Vokale.
Konsonanten und Atemstrom
Alle Konsonanten werden der ausgeatmeten Atemluft eingeprägt. Je nachdem wie der Atemstrom an der Gestaltung der Konsonanten beteiligt ist, kann man zwei große Gruppen von Konsonanten unterscheiden:
|
Blase-, Reibe-, Zisch- oder
Hauchlaute |
H, CH, SCH, Z, S, W, F |
Sie entstehen, wenn man den Atem frei strömen läßt, so daß er an Gaumen, Zähnen, Lippen bloß vorbei streicht
und sich daran reibt. |
|
Stoß- und Explosionslaute |
B, P, M, N, D, T, L, R, G, K |
Hier muß sich der Atemstrom zunächst durch einen
Verschluß an verschiedenen Stellen der Sprachorgane kraftvoll
mehr oder weniger plötzlich, d.h. härter oder weicher, durchsetzen. Wichtig ist, daß die Atemkraft zuerst gesammelt werden muß, bevor sie sich durchsetzen kann. |
SILBEN und WORTE
Silben bestehen in der Regel aus einem Vokal und einem oder mehreren Konsonanten. Im Vokal lebt das Gefühl, das den Sprachklang entsprechend färbt. Wichtig ist, daß mit dem Klang zugleich rein innerlich andere Sinnesqualitäten mitempfunden werden. Klänge können als warm oder kalt, dunkel oder hell, ja sogar als farbig empfunden werden. Das sollte nicht als bloße Metapher angesehen werden, sondern unmittelbares starkes Erlebnis sein. Man muß die Wärme eines Lautes geradezu körperlich spüren und die Farbe eines Vokals beinahe mit Augen sehen. Diese Fähigkeit (man spricht in der Psychologie von Synästhesie), die nur wenige Menschen von Natur aus haben, sollte der Künstler soweit als möglich bewußt ausbilden. Das erfordert, daß die Laute sehr differenziert gesprochen werden und daß man sehr aufmerksam auf ihren reinen musikalischen Klang hört, ohne sich durch den begrifflichen Inhalt zu sehr ablenken zu lassen. Dabei kann man keineswegs den einzelnen Vokalen bestimmte Farb- oder Wärmeerlebnisse abstrakt zuordnen. Zwar werden die Laute E und I eher hell, die Laute A, O und U eher dunkel erlebt, das U wirkt eher kühl, das O warm usw., aber in einer gegeben konkreten Situation, d.h. in einem bestimmten Wort, Satz oder Absatz kann sich das auch wesentlich ändern. Oft entsteht die künstlerische Wirkung gerade dadurch, daß ein bestimmter Vokal gerade seinem naturgemäßen Charakter entgegen wirkt. Jeder Laut muß also ganz bewußt in der jeweiligen Situation erlebt werden, und man muß empfinden wie dadurch eine ganz bestimmte innere Seelenstimmung erregt wird. Diese innere Seelenbewegung kann dann wiederum bis zur äußeren Geste weitergeführt werden (vgl. den Abschnitt über Gestik).
Im Konsonanten wirkt besonders stark der Wille, der äußere Formen nachbilden will. Auch dieses Erlebnis muß so sehr gesteigert werden, daß man geradezu vermeint diese Formen mit Händen greifen zu können. Mit jedem Konsonanten muß synästhetisch der Tastsinn und der Eigenbewegungssinn und der Gleichgewichtssinn mit erregt werden.
Mit den Vokalen schwingt also vorallem das mit, was man durch die oberen Sinne erleben kann: Farben, musikalische Klänge, Wärme und Kälte, seltener bestimmte Geschmacks- oder Geruchserlebnisse. Mit den Konsonanten wiederum gehen vorallem Begleiterlebnisse der unteren Sinne einher, also Schwere, Härte, Formen usw. In den Silben und Worten, in denen sich Vokale und Konsonanten miteinander verbinden, streben auch diese beiden Erlebnissphären zusammen und lassen ein ganz konkretes inneres Bild entstehen. In diesem ganz gesetzmäßig gebauten inneren Vorstellungsbild lebt sich die Ansicht aus, die man sich von einem bestimmten Gegenstand oder Ereignis gebildet hat. Jedem Wort liegt ursprünglich ein solches inneres Bild zugrunde, das auf den bezeichneten Gegenstand hinweist. So ist überhaupt ganz instinktiv die Sprache entstanden. Dieses konkrete bildhafte Erleben ist allerdings nach und nach immer mehr verblaßt und nur mehr der abstrakte Begriff übergeblieben. Wo das bildhafte Erleben nicht mehr vorhanden war, konnte sich auch allmählich die Bedeutung der Worte wandeln; sie zeigen heute vielfach nicht mehr exakt auf die ursprünglichen Erfahrungen und so klaffen bezeichneter Gegenstand und innerliches Bild oft auseinander – was aber kaum jemand auffällt, weil er das innere Bild ohnehin nicht erlebt. Die Sprache bekommt dadurch ein konventionelles, vereinbarungsmäßiges Element. Das stört die meisten heute nicht, da sie ohnehin das Wort nur auf einen bestimmten abstrakten Begriff beziehen und die dabei verwendete Lautkombination als mehr oder weniger willkürlich empfinden. Dieses Empfinden steigert sich noch dadurch, daß verschiedene Sprachen ein und denselben Gegenstand durch ganz verschiedene Lautkombinationen charakterisieren. Schließlich ist ein Gegenstand objektiv gegeben und müßte doch von allen gleich gesehen werden. Das ist aber ganz abstrakt gedacht. In Wahrheit kann man sich von ein und demselben Gegenstand sehr wohl ganz verschiedene Ansichten bilden. Ein Volk richtet mehr auf diese, ein anderes mehr auf jene Aspekte sein Augenmerk. Jedes Objekt wird immer von einem bestimmten subjektiven Standpunkt aus betrachtet. Es gibt keine für sich bestehende "objektive" allgemeingültige Wahrheit, sondern jedes Objekt muß notwendig aus einem ganz bestimmten subjektiven Blickwinkel angeschaut werden. Nur weil wir uns dieses subjektiven Standpunktes nur allzu oft nicht bewußt sind, kann die falsche Meinung entstehen, daß man sich von einem Ding nur eine einzige mögliche Ansicht bilden könnte. Was so schon für äußere Gegenstände gilt, das gilt noch mehr für innere Erlebnisse wie Haß, Liebe, Schmerz, Lust usw. So gibt es zwar keine "objektive", und schon gar keine "subjektive" Wahrheit, aber es gibt mehr: nämlich eine absolute und unverrückbare Wahrheit; und die ist immer dann gegeben, wenn man sich von einem ganz bestimmten subjektiven Standpunkt aus ein richtiges, ein zutreffendes Bild des gegebenen Objektes macht! Alle Worte entspringen einer solchen zutreffenden Ansicht des Gegenstandes von einem bestimmten subjektiven Standpunkt, der sich aus dem jeweiligen Volkstemperament ergibt. Daß in südlichen Sprachen, etwa im Arabischen, sehr häufig der Vokal A vorkommt, im Deutschen das E überwiegt und im Englischen das U, ist keineswegs zufällig, sondern hängt beispielsweise eng mit dem Klima und der Landschaft zusammen, in der diese Völker leben. Im warmen Süden öffnet sich die Seele leicht der unendlichen Weite der Wüste und dem darüber ausgespannten Himmelszelt, und damit ist eigentlich schon das Grunderlebnis bezeichnet, das sich im Vokal A auslebt. Im kühlen, regnerischen und nebeligen England tut man wohl daran, sich vor der Kälte zu schützen und den Mund möglichst wenig aufzutun – und das ist am stärksten im U der Fall! Und daraus erklärt sich überhaupt die ausgesprochene "Maulfaulheit" der englischsprachigen Welt. Zugleich steht man der äußeren Welt mit einer gewissen nüchternen Kühle gegenüber, man verbindet sich seelisch nur wenig mit ihr und betrachtet sie mehr von einem pragmatischen Standpunkt. Damit ist aber zugleich der allgemeine Volkscharakter des Briten gekennzeichnet, von dem sich aber selbstverständlich jedes einzelne Individuum mehr oder weniger weit entfernen kann! Aber die Sprache ist eben, was ihre Worte, d.h. ihre Lautkombinationen betrifft, notwendigerweise überindividuell, d.h. volksgemäß – und daher lebt sich auch in der Sprache dieser seelische Grundcharakter der Völker deutlich aus, auch wenn die einzelnen Menschen in ihrem Empfinden davon mehr oder weniger abweichen. Der Schauspieler, dessen Werkzeug vorallem die Sprache ist, muß sich daher auch sehr stark in den tieferen Charakter seines Volkes einleben (was mit Nationalismus nicht das geringste zu tun hat!); denn hier findet er die Grundkräfte, aus denen heraus er seinen Vortrag gestalten muß. Und das geschieht eben gerade dadurch, daß er jeden Vokal intensiv aus vollem Atem erklingen läßt, daß er jeden Konsonanten so plastisch als möglich gestaltet, auf alle mit dem Klang verbundenen synästhetischen Begleiterlebnisse aufmerksam wird und schließlich die Lautverbindungen zum ganz bewußten bildhaften Erleben erhebt, das zumindest so intensiv wie ein heftiges Traumerlebnis sein muß – ohne dabei die klare Besonnenheit des wachen Verstandes zu verlieren. Das unterscheidet gerade den modernen Künstler von dem alten, der alles aus seinem Naturtalent heraus geschaffen hat. Wir heutigen Menschen sollen, wir müssen uns den nüchternen Verstand bewahren – allerdings darf er beim Künstler ausschließlich aufmerksam wachender Beobachter sein, aber niemals tätig in die künstlerische Gestaltung eingreifen: die muß nämlich alleine aus dem schöpferischen Willen und den sich daran entzündenden Gefühlen hervorgehen! Man muß gleichsam schöpferisch tätig werden ohne zuvor zu wissen, wie man dabei eigentlich vorgehen soll. Man muß anfangen tätig zu sein, man muß spüren, ob man sich bei dem, was so entsteht wohl fühlt oder nicht und ob man das Getane als schön oder unschön empfindet, und aus diesen Erlebnissen heraus muß man von neuem mit der Übung beginnen. Je öfter man das tut, desto besser wird auch das werden, was dabei herauskommt, wenn sich ein durchgreifender Erfolg auch vielleicht erst nach Tagen oder Wochen einstellt. All das soll der Verstand wachsam verfolgen; dann kann er sich danach auch bewußt Rechenschaft geben von den inneren Gesetzmäßigkeiten dessen, was wir so aus unmittelbarem Erleben getan haben. Wir haben uns dann nicht nur eine künstlerische Fähigkeit angeeignet, sondern wir wissen auch, worauf sie gesetzmäßig beruht, und wir sehen dann auch sehr leicht, wo unsere Stärken liegen und woran wir noch besonders arbeiten müssen. Wir können so zum qualifizierten Kritiker unserer eigen Leistung werden, wir werden uns weder überschätzen noch unterbewerten – beides ist in gleichem Maß schädlich. Damit ist zugleich der Vorteil erwähnt, den sich der moderne Künstler gegenüber dem alten erwerben kann. Das Naturtalent besitzt von vorneherein bestimmte gute Fähigkeiten, aber es kann sie kaum objektiv einschätzen und daher auch oft nicht gezielt weiterentwickeln. Diese Fähigkeit, die aber eben des wachsamen Verstandes bedarf, muß den modernen Künstler auszeichnen!
Wortimaginationen
"Gewöhnlich stehen hinter den Worten unserer Alltagssprache Verstandesinhalte oder abstrakte Gedanken, die gar nicht zulassen, daß die künstlerische Ausdrucksebene erreicht wird. Auf der Bühne lassen wir die Sprache oft noch mehr verkommen, indem wir ihr sogar den Verstandesinhalt noch wegnehmen. Die Worte werden zu leeren Lauthülsen. Der Schauspieler hat solche Worte bald satt und fühlt sich von ihnen bei der Arbeit an der Rolle behindert. Er fängt an, sich selbst Gefühle aufzuzwingen, greift zu »Stimmklischees«, denkt sich Intonationen aus, »legt Druck« auf einzelne Worte usw. Er lähmt damit seinen schöpferischen Impuls.
Eines der besten Mittel, die Sprache zu beleben und über das Alltägliche zu erheben, ist Ihre Imagination. Das Wort, hinter dem eine Gestalt steht, gewinnt Ausdruckskraft und verliert, sooft Sie es wiederholen, seine Vitalität nicht. Sie können Ihre Sprache beleben, indem Sie die Szenen herausnehmen, die Ihnen für das Stück insgesamt oder für Ihre Rolle zentral scheinen, und aus den Leitsätzen darin die wichtigsten Worte herausgreifen und in Gestalten verwandeln. Die Ausdrucksfähigkeit Ihrer Sprache erweitert sich immer mehr, bis über die Grenzen Ihrer Worte hinaus, und weckt in Ihnen immer mehr die Freude am Schöpferischen, während Sie Ihre Rollentexte sprechen."
M. Cechov, S 71
BAUM
|
TREE
|
ARBOR
|
ARBRE
|
|
deutsch |
englisch |
lateinisch |
französisch |
universelle Lautbedeutung
|
|
B
ist die aufgeblähte Blase;
AU erfüllt die Blase durch und durch; gibt dem ganzen Wort einen warmen, dunklen Klang.
M ergreift, verkostet mit den Lippen. |
T
stellt fest und unverrückbar etwas hin;
Im R beginnt sich innerlich etwas zu regen, etwas treibt nach außen;
Im I (denn so wird das doppelte E gesprochen) schießt nach allen Seiten etwas strahlig nach außen; es klingt hell und kalt. |
A
bedeutet, daß sich etwas öffnet,; es ist dunkel und warm.
Im R regt sich etwas;
Im B bläht sich etwas auf;
Im O rundet es sich, wird zugleich noch dunkler und wärmer;
Im R dreht sich etwas, die Rundung wird tätig vollendet. |
Anfangs analog wie nebenan (A-R-B);
Dann aber regt sich im R nochmals etwas stark;
Im E entzweit sich schließlich etwas, wird abgetrennt, zerrissen. |
mögliche Bildvorstellungen
|
|
Ein sommerlich dicht belaubter dunkler, schattenspendender Baum, der mit mächtigen Wurzeln in die Erde greift und ihre Säfte genußvoll verkostet. |
Ein kahler Baum im Winter, umgeben vom gleißend hellen weißen Schnee; man sieht den festen Stamm, aus dem nach allen Seiten die Äste hervorschießen. |
Die Blüte öffnet sich in zuerst voller Farbenpracht; darinnen reift dann die Frucht, schwillt an und bläht sich rundlich auf. |
Wie nebenan, doch wird die Frucht gewaltsam abgerissen. |
Die Formkräfte der Konsonanten und die Grundstimmungen der Vokale sind universell für jeden Menschen und für jede Sprache gültig. In jedem Wort sind derart ganz bestimmte Stimmungen und gestaltende Bildekräfte vorgegeben. Diese müssen aber nun benutzt werden, um sich damit selbst ein bestimmtes individuelles Vorstellungsbild aufzubauen. Jeder kann und muß sein eigenes Bild finden; was oben beschrieben ist, ist nur jeweils ein mögliches Beispiel. Obwohl man also so sein Bild sehr frei aufbauen kann, ist es dennoch keineswegs willkürlich, denn ein richtiges, d.h. ein den Lauten gemäßes Bild wird nur entstehen, wenn man es aus den allgemeingültigen Form- und Gemütskräften der vorgegeben Laute entwickelt. Wir vollziehen dann bewußt eine ähnliche Tätigkeit, wie sie sich unbewußt abspielt, wenn wir träumen. In Träumen können sich beispielsweise innere organische Zustände symbolisch bildhaft ausdrücken. Ein beginnender leiser Kopfschmerz etwa kann so empfunden werden, daß man sich in einer dumpfen, stickigen Höhle gefangen glaubt, oder auch in einem finsteren Verließ, in einem von Lokomotivrauch erfüllten Tunnel usw. Sehr verschiedene Bilder sind möglich, aber in allen drückt derselbe Schmerz aus, der sich unter der gewölbten Schädeldecke regt. Eine Verdauungsstörung in den Gedärmen symbolisiert sich im Traum meist als Schlangenbrut, vielleicht aber auch als sich ringelndes Gewürm oder gar als bedrohlicher Drache. Immer sind es ganz sachgemäße Bilder, die so ohne unser bewußtes Zutun entstehen, und ebenso sachgemäß müssen die individuellen Bilder sein, die wir uns aus dem Lautzusammenhang entwickeln.
Übungsbeispiele
FISCH
und TISCH
TABLE
(engl. "täbl"), TABLE (frz.
"tabl")
TABLEAU
(frz. "tabloo")
FRUCHT
und FURCHT
LICHT
und nicht
LEBEN
und BEBEN
KNOSPE
und BLÜTE
LIEBE
und HIEBE
FLUCH
und FLUCHT
WASSER
und WELLE
HAUS
(ident. mit engl. House) und HOF und HEIM
HOME
(engl. "hoom")
HUT, HÜTE, HÜTTE
GEFAHR
und GEFÄHRT
HOMO
(lat. "Mensch") und homo- (griech. "gleich")
HUMUS
und ERDE
MENSCH, MANN und MANUS (lat. "Hand")
machen, merken, melken und
lachen, lernen, Nelken
KOPF, CAPUT
(lat.),
CAPO
(it. Kopf, Oberhaupt)
TESTA
(it. Nuss, Kopf, Gehirn)
TÊTE
(frz. Kopf, "tät")
ICH
und DU
ER
und SIE
Vorsilben wie ge-, be-, ver- usw.:
LUST
und VERLUST
finden
und befinden und empfinden
Nachsilben, Endsilben wie –er, -en, -ung
TAT
und TÄTER
LEBEN
und LEBER
GEFAHR
und gefährlich
Achtung vor einer möglichen Falle, die die ganze Übung verdirbt:
Auch wenn man einigermaßen den allgemeinen Empfindungsgehalt der einzelnen Vokale und die Formkräfte der Konsonanten kennt, so kann man daraus dennoch niemals daraus abstrakt das Bild konstruieren. Durch wiederholtes deutliches Sprechen muß vielmehr der Lautzusammenhang immer deutlicher erlebt werden, bis er sich beinahe von selbst zum Bild formt; alles was man über die Kräfte der Laute bereits weiß, muß man sozusagen während der Übung willentlich vergessen, es unterdrücken. Man muß die gestaltenden Kräfte der Sprache jedesmal völlig neu erleben, so als würde man ihnen das aller erstemal begegnen. Dann erlebt man sie zwar auch in ihrer unverwechselbaren Charakteristik, aber so nuanciert, wie es sich aus dem gesamten Lautzusammenhang des betrachteten Wortes ergibt. Das Wort ist nicht aus für sich bestehenden Lauten zusammengesetzt, sondern es gliedert sich in einzelne Laute, in denen sich der allgemeine Stimmungs- oder Formcharakter auf besondere, jeweils einzigartige Weise ausdrückt.
Auch darf man sich dadurch irritieren lassen, daß das Bild, das so entsteht, oft keinen klaren Bezug zu dem bezeichneten Gegenstand liefert. Das kann häufig vorkommen; dann ist es besser, einfach das Bild für sich stehen und wirken zu lassen, ohne es krampfhaft so hinzubiegen, daß es dem Begriff entspricht, den man sich von dem betreffenden Gegenstand gemacht hat. Vielleicht kommt ja dieser Verstandesbegriff aus einer ganz anderen Ecke als das Bild das man sich aus den Lauten geschaffen hat; und dieses Bild muß auch keineswegs ein äußeres Abbild des Gegenstandes sein, sondern kann auch ein bestimmtes inneres Erlebnis oder eine Tätigkeit bedeuten, die an dem Gegenstand anknüpft. Wir haben ja auch besprochen, daß die heutige Wortbedeutung sich oft weit von dem ursprünglichen Bildgehalt der Laute entfernt haben kann. Wichtig für unsere Übung ist nur, daß überhaupt ein kräftiges, deutliches Bild entsteht, das den Lauten entspricht; alles weitere kann man dann getrost abwarten – es ist nicht notwendig, möglichst rasch zu einem abschließenden Urteil zu kommen. Manchmal muß dann eben unser abstrakter Verstand damit leben, daß er nicht gleich wunschgemäß befriedigt wird. Das ist zwar für uns moderne Kopfmenschen höchst unbehaglich, schadet aber dem künstlerischen Herzmenschen gar nicht – und der muß in unserem Fall immer die Führung haben.
NATUR- und MENSCHENSPRACHE
Von allen irdischen Lebewesen ist der Mensch als einziger bewußt der Sprache mächtig. Zwar gibt es reiche Kommunikationsformen auch im Tierreich, man denke nur an die zauberhaften und höchst komplexen Gesänge der Wale, aber Sprache im menschlichen Sinne ist das noch nicht. Dennoch ist die Natur nirgendwo vollkommen stumm; sie spricht für den, der sie zu hören vermag, in einer verständlichen Sprachen, in der er seine eigene, wenn er nur will, wiederzuerkennen vermag. Steine und Pflanzen erscheinen uns zwar überhaupt stumm, sie können ihr innerstes Wesen nicht selbsttätig im Laut offenbaren. Wenn sie erklingen, dann nur, wenn sie von außen dazu angeregt werden. Aber dann zeigen sie uns auch sogleich ein ganz klein wenig von ihrer inneren Natur. Ein silbernes Glöckchen mit ihrem hellen strahlenden Klang spricht ganz anders zu uns als ein rohes eisernes Gefäß, das wir anschlagen; sprödes Gußeisen tönt anders als elastischer Stahl. Und wenn der Wind durch den dichten Tannenwald rauscht, dann spricht es nicht so zu unserer Seele, als wenn er ein Birkenwäldchen zaust. Das Bächlein gurgelt leise, der Fluß rauscht und Meereswellen rollen über das Ufer – Naturgeräusche, die wir in unserer menschlichen Sprache nacherleben können.
Wie Steine und Pflanzen können die niederen Tiere keine Töne selbsttätig aus ihrem Inneren hervorzaubern, aber sie können oft äußerlich mit ihrem Körper typische Geräusche erzeugen. Das charakteristische Zirpen der Grillen etwa entsteht, wenn sie ihre haarigen Beine am Chitinpanzer ihres Körpers reiben; viele Insekten erkennt man am unverwechselbaren Surren ihrer Flügel, sei es das dumpfe Brummen einer Hummel oder das helle Singen der
Gelsen. Welche Geräusche so entstehen, hängt ganz vom Körperbau und den arttypischen Bewegungen dieser Tiere ab, aus ihnen spricht ihre bewegte Form – und das ist ein entschieden konsonantisches Element, denn jeder Konsonant ist eine hörbar gewordene Bewegungsform. Tiere sind, was Menschen haben. Das Tier ist seiner bewegten Gestalt nach ein gleichsam verkörperter Konsonant; der Mensch hat alle Konsonanten in seiner Sprache frei verfügbar.
Erst die höheren Tiere, und ganz besonders die warmblütigen Säugetiere, die ihrer ganzen Natur nach dem Menschen bereits sehr nahe stehen, beginnen von innen heraus zu tönen. Und was sie derart in die Welt hinaus schreien, brüllen oder heulen, in dem erklingt unmittelbar Lust und Leid ihres inneren seelischen Erlebens, das untrennbar mit ihrem körperlichen Wohlbefinden, mit ihrer überschäumenden Lebenskraft oder mit ihrem organischen Mangel zusammenhängt. Ein vokalisches Element gibt sich hier kund. Im Vokal ertönt immer Seelisches. Aber alle Töne, die so aus dem Inneren des Tieres hervorbrechen, wurzeln zugleich ganz tief in ihren körperlichen Prozessen, in ihrer Atmung, namentlich aber auch in den Rhythmen ihres Stoffwechselorganismus. Der ganze Körper des Tieres spricht, und Stimmbänder und Kehlkopf sind hier mehr ein dienendes Glied der Lauterzeugung, nicht ihr beherrschendes Zentrum.
Auch wenn der Mensch spricht, wirkt daran sein ganzer Körper mit, aber was die tierischen Laute zur menschlichen Sprache erhebt, das strahlt direkt von seinen Sprachorganen aus. Von den Stimmbändern und vom Kehlkopf aus werden dem Atemstrom die vokalischen Klänge aufmoduliert, die leisen plastischen Verformungen des Rachens und Gaumens, die immer entstehen, wenn wir sprechen, geben den Konsonanten ihre unverwechselbare Form. Erst im Menschen trifft das äußere konsonantische Element, indem es bis in den Gaumen hinein verinnerlicht wird, mit dem vokalischen Element zusammen, das aus der Tiefe des Körpers bis in den Kehlkopf heraufgehoben wird. Und hier verbinden sich die Vokale und Konsonanten miteinander zur Silbe, zum Wort, indem sich schließlich auch der Begriff, der Gedanke aussprechen kann. Das Wort, das hier entsteht, wirkt dann durch seinen vereinten vokalischen und konsonantischen Klang auf den ganzen Körper zurück. Beim Tier entsteht der Laut aus und durch den Körper; beim Menschen strahlt das Wort bestimmend in den Körper zurück. Wie sich das Tier körperlich befindet, das spricht sich seelisch durch die Laute aus, die aus seinem Inneren hervorbrechen. Ähnlich ist es beim Menschen, wenn er etwa vor Schmerzen ächzt und stöhnt oder aus rein körperlichem Wohlbefinden jauchzt; aber das ist noch nicht menschliche Sprache, ist nicht Gefühl, das durch sie hörbar wird, sondern bloß aus der Leibestiefe aufsteigende Emotion. In der menschlichen Sprache spricht rein Seelisches, das sich völlig unabhängig davon entwickelt, wie sich der Leib gerade befindet, zum und durch den Körper. Genau umgekehrt als beim Tier geht hier der Weg.
Nur deshalb ist der Mensch menschlicher Sprache fähig, weil er ein aufrecht gehendes Wesen ist – als einziges von allen Naturgeschöpfen: denn keinem einzigen Tier ist die vollkommene Aufrichtung natürlicherweise und dauerhaft gegeben; für den Menschen ist aber ist sie unverzichtbar. Tiere, die wenigstens über einen aufrechten Kehlkopf verfügen, wie beispielsweise die Papageien, können immerhin die menschliche Sprache in begrenztem Umfang nachahmen, ohne sie allerdings inhaltlich zu begreifen. Weil der Mensch ein aufrechtes Wesen ist, steht sein Seelenleben auch in einem ganz anderen Verhältnis zu seinem Körper als beim Tier. Was das Tier erlebt, ist unmittelbar körperlich bedingt. Was es durch seine Sinne wahrnimmt, wirkt unmittelbar und ungehemmt auf seine körperbedingten Triebe, wie auch sein Körperbefinden darauf zurückwirkt, wie es gerade die Welt wahrnimmt. Das hängt damit zusammen, daß der Kopf mit den wesentlichsten Sinnesorganen in derselben Ebene liegt wie die Stoffwechsel- und Reproduktionsorgane, verbunden durch das horizontal in der Fortbewegungslinie des Tieres liegende Rückenmark, das das entscheidende Werkzeug des tierischen Seelenlebens ist. Beim Menschen hingegen thront der Kopf mit dem Sinneszentrum weit über den Stoffwechselorganen; das Rückenmark steht genau senkrecht zur Bewegungsrichtung des Menschen und ist für sein bewußtes seelisches Erleben weniger bedeutend als das Gehirn, das gleichsam alle Sinneseindrücke erst zurückstaut, ehe sie auf den ganzen Körper wirken dürfen. Beim Tier sind äußere Wahrnehmung und innere triebhafte Emotion zu einem unentwirrbaren Knäuel verbunden; beim Menschen schiebt sich zwischen die körperlich bedingte Wahrnehmung und Emotion das eigentlich menschliche Seelenleben ein, das dem Tier noch vollkommen fehlt. Dieses menschliche Seelenleben gliedert sich in Denken, Fühlen und Wollen; es bedarf zwar unseres Körpers, damit es uns so bewußt werden kann, wie wir es aus dem alltäglichen Leben kennen, aber inhaltlich ist es vom Körper ganz unabhängig. Es läßt sich durch diesen nicht bestimmen, sondern wirkt vielmehr selbst bestimmend auf ihn zurück und schafft sich in der Sprache, und weiters auch in der Gestik und Mimik, ein adäquates Ausdrucksmittel. Durch den Vokal spricht das Gefühl, nicht bloß die Emotion, wenngleich sie oft leise mitschwingt; durch den Konsonanten drückt sich der beherrschte Wille, nicht der blinde Trieb aus. In der Silbe, im Wort vereinigen sie sich zu einem sinnvollen inneren seelischen Bild, das zugleich äußerlich hörbar wird. Jedem Wort liegt ein solches schöpferisches inneres Bild zugrunde, indem sich seelisch ausdrückt, was der Mensch an der Welt und durch sich selbst als sinnvollen Zusammenhang empfindet. Und aus diesem Bild, ob es sich nun nach außen als hörbares Wort offenbart oder nicht, löst das Denken endlich den klar erfassten Verstandesbegriff los, der darin lebt. Dieses innere Bild, das uns in unserer Alltagssprache aber meist gar nicht bewußt wird, ist der Quellort der menschlichen Sprache, wo die ganze Natur, bis herauf zum Menschen, seelisch wiedergeboren wird. Hier ist die geheime Schatzkammer, zu der der Dichter, der Sprachkünstler, ja jeder Künstler, bewußt oder halb traumhaft bewußt, vordringen muß, wenn er schöpferisch gestalten will.
Hexameter
Wie sich die Atemluft einiget - / Helligkeit bringend und Leichtigkeit - /
rhythmischen, rollenden, rauschenden, / wärmenden kraftvollen Blutstrom. /
Also ist weites Schwingen / durchdrungen vom vierfachen Taktschlag: /
Urharmonie des Hexameters, / menschlicher Maßzahl entsprungen. /
So auch im Gang der Geschichte wohl, / Zeiten und Räume verknüpfend,/
rauscht in gewaltigem Nachklang / heldisches Schicksal im Epos .../
Der Hexameter ist die Kunstform, die die großen epischen Dichtungen eines Homer oder Hesiod kennzeichnen. Das Epos schildert überpersönliche Ereignisse; es berichtet von den Taten der Götter und von ihren irdischen Stellvertretern, den Heroen, den Helden, die die Geschicke des Volkes, des Kollektivs bestimmt haben. Das persönliche Leid und die persönliche Freude haben im Epos ursprünglich keinen Platz.
Der Hexameter ist ganz auf die Gesetzmäßigkeiten des rhythmischen Systems des Menschen abgestimmt. Im entspannten Zustand kommen auf einen Atemzug ziemlich genau vier Pulsschläge. Dem entsprechend enthält die erste Halbzeile des Hexameters drei betonte Silben, entsprechend drei Pulsschlägen, mit dem vierten Pulsschlag erfolgt das neuerliche Einatmen. Gestalterisch entsteht dadurch eine Atempause, in der zwar äußerlich kein Laut ertönt, aber innerlich der Pulsrhythmus unverändert weiterläuft. Die Pause wird dadurch zu keiner Unterbrechung, sondern wird von kontinuierlichem inneren Erleben erfüllt. In der zweiten Halbzeile des Hexameters folgen dann wieder drei betonte Silben, und am Ende der Zeile, mit dem vierten Pulsschlag, atmet man neuerlich ein.
Dieses regelmäßige Verhältnis von 4 Pulsschlägen auf einen Atemzug wirkt auf den menschlichen Organismus äußerst gesundend und erfrischend zurück, und normalerweise stellt sich dieses Verhältnis beinahe exakt in der Nacht ein, wenn wir schlafen. Der ganze Körper entspannt und entkrampft sich, zugleich aber wird das Bewußtsein herabgedämpft. Tagsüber, wenn wir wachen, weichen Atem- und Pulsrhythmus mehr oder weniger von diesem gesunden Verhältnis ab. Nur dadurch können wir überhaupt unser Wachbewußtsein aufrecht erhalten; es ist aber dadurch erkauft, daß sich der ganze Organismus des wachenden Menschen, uns meist unbewußt, beständig ganz leise verkrampft. Wie man heute aus vergleichenden Studien weiß, ist bei typischen Morgenmenschen meist der durchschnittliche Puls-Atem-Quotient über 4 erhöht, und sie sind oft eher extrovertierte und sinnesfreudige Menschen, während bei Nachtmenschen, die häufig introvertierter und grüblerischer veranlagt sind, dieser Quotient deutlich unter 4 absinkt. Goethe etwa, der sich sehr stark in die reine unverfälschte Sinneswahrnehmung eingelebt hat und daraus etwa zu seiner Farbenlehre gekommen ist, war ein ganz typischer Morgenmensch. Der viel mehr auf das Denken hin orientierte Schiller aber war ein ausgesprochener Nachtmensch.
Alle wirkliche Kunst, die ihren Namen verdient, wirkt harmonisierend und folglich auch gesundend auf sämtliche Körperrhythmen, besonders auf Puls- und Herzrhythmus zurück. Das Schöne überwindet das Häßliche, das rhythmisch Geordnete das arhythmisch Chaotische – das haben besonders stark die Griechen empfunden, daher wird auch für sie der ganze in Schönheit prangende Kosmos aus dem Chaos geboren: und diese Weltschöpfung ist ihnen zugleich das Vorbild für ihr künstlerisches Schaffen, und zugleich spüren sie, wie alle Kunst, ganz besonders aber Dichtung und Musik, auch eine besondere therapeutische, heilende Kraft besitzt. Ähnlich hat noch Goethe die Kunst aufgefaßt. Er sieht, wie sich im Kunstschaffen die selben harmonischen Gesetze offenbaren, die auch dem Werden der Natur zugrunde liegen. Nur ist die Natur, so wie sie jetzt ist, noch nicht vollendet, Chaos und Kosmos, rhythmische Ordnung und wesenlose Unordnung sind in ihr noch gemischt. Wo die Natur aufhört, dort muß, so Goethe, der Künstler weitertun; indem er der Natur die in seiner Seele empfundene Ordnung einprägt, überhöht er sie zur Kunst. Naturalismus, der reine Abklatsch des ohnehin schon natürlicherweise Gegebenen, kann niemals Kunst im eigentlichen Sinne sein. Daher hat auch etwa der griechische Plastiker niemals nach einem äußeren Modell gearbeitet und es einfach abgebildet, sondern er hat das harmonische Idealmaß des Menschen innerlich empfunden und danach seine Statuen geschaffen. Er wollte gleichsam im Stein ein Bild des idealen menschlichen Körpers hinstellen, das sich so nirgendwo natürlicherweise findet. Erst etwa seit der Renaissance, auf die allerdings schon in der römischen Kunst in gewissem Sinne vorgegriffen wurde, arbeitete man zwangsläufig nach äußeren Modellen, weil man dieses innere Körpergefühl der griechischen Zeit verloren hatte. Alle Renaissancestatuen sind daher auch um vieles naturalistischer als die griechischen. Gerade dadurch sind sie aber auch zugleich viel individueller geprägt und nicht nur einem allgemeinmenschlichen Idealbild entsprechend. Was so der Renaissancekünstler einerseits an künstlerischer Fähigkeit verloren hat, das konnte er nun auf anderem Gebiet umso mehr wettmachen. Der griechische Künstler der klassischen Zeit konnte und wollte das Individuelle nicht darstellen, es erschien ihm geradezu als häßlich, als unvollkommen. Die neuere Zeit drängt immer mehr danach, alles künstlerische zu individualisieren. Daher kann man auch heute kaum mehr von epochemachenden Stilrichtungen sprechen, wie noch etwa bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Ist dann aber überhaupt noch Kunst, sofern man sie im hier angesprochen Sinn versteht, möglich? Diese Frage muß entschieden bejaht werden. Auch wenn davon derzeit noch wenig zu bemerken ist, kann der Kunst eine große Zukunft bevorstehen. Wir haben uns zwar immer mehr vom Idealbild der hinter der Natur waltenden allgemeinen Weltrhythmen entfernt, wir können folglich keine griechischen Künstler, ja nicht einmal mehr Renaissancekünstler usw. sein, aber wir können – und müssen, wenn wir Künstler sein wollen - einen ganz lebendigen, vollkommen individuellen Rhythmus unserem künstlerischen Schaffen zugrunde legen. Und wir können uns dabei doch künstlerisch mit allen Menschen verständigen. Wir haben zwar den allen Menschen gemeinsamen reinen Naturrhythmus verloren, aber was wir als individuelle rhythmische künstlerische Gestalt hervorbringen, ist letztlich genau dieser Rhythmus, aber jetzt in individuell modifizierter Form. Er steht daher auch nicht im Widerspruch zu unserer allgemeinen menschlichen Natur, sondern drückt diese vielmehr nur in besonderer, unverwechselbarer einmaliger Weise aus. Nicht das Chaos, die Willkür, tritt anstelle der allgemeinen Ordnung, obwohl das im heutigen Kunstbetrieb vielfach der Fall ist und sich viele Künstler nennen, die es eigentlich nicht sind, sondern ein individualisierter, ganz menschlicher "Kosmos" entsteht. Moderner Künstler kann nur der sein, der gleichsam die aller Welt zugrundeliegende rhythmische Ordnung zu individualisieren weiß – und zwar nicht nur, und das ist entscheidend, auf seine persönlich egoistische Art, sondern wenn er, ganz abgesehen von sich selbst, individualisieren kann. Es wird wenig helfen, wenn ein Maler, der einen bestimmten Menschen porträtieren möchte, dem Bild bloß seinen eigenen Rhythmus aufprägt; er muß vielmehr den Lebensrhythmus der dargestellten Person erfassen und so darstellen, daß er im Bild reiner sich ausdrückt als im Leben der porträtierten Person selbst. Denn kein Mensch kann den individuellen Rhythmus, die innere Ordnung, die seinem individuellen Wesen zugrunde liegt, wirklich vollkommen ausleben. Jeder Mensch hinkt gleichsam seinem eigenen Idealbild nach. Der Künstler muß gerade dieses erfassen und durch seine Kunst darstellen. Wenn ein Schauspieler eine Rolle gestaltet, dann darf er nicht sich selbst darstellen, und gelänge ihm das noch so großartig, sondern er muß den ganz spezifischen Rollencharakter verkörpern – selbst wenn ihm dieser vollkommen gegen den Strich geht. Und doch wird zugleich jeder Schauspieler, auch wenn er die Rolle vollkommenen verkörpert, sie auf seine unverwechselbare individuelle Weise spielen. Keine zwei Schauspieler werden sie gleich gestalten, und sogar ein und der selbe Schauspieler wird ein und die selbe Rolle in einem anderen Lebensabschnitt ganz anders darstellen, weil er selbst inzwischen ein anderer Mensch geworden ist. Das tut der Kunst keinen Abbruch, im Gegenteil, was so entsteht, ist nämlich eine innere Zwiesprache von Individuum zu Individuum, von Schauspieler und Rollencharakter, und gerade diese geistige Zwiesprache erhöht das Individuum, ohne daß es sich dabei verliert, zu einem überindividuellen Geschehen, das letztlich auch das Publikum mit einbezieht!
Kunst kann niemals das reine Schöne, die vollendete harmonische Form erreichen.
Jedesmal, wenn eine Kunstepoche diesem Ziel ganz nahe gekommen ist, bedeutete das zugleich das Ende ihres fruchtbaren Wirkens. Die griechische Kunst etwa ist auf ihre Art vollendet und sie konnte daher nicht einfach weitergeführt werden, wenn noch etwas künstlerisch Wertvolles entstehen sollte. Sie lief Gefahr, zur ewigen abgeschmackten Kopie ihrer selbst zu verkommen, was anhand so mancher römischen Nachbildung griechischer Kunstwerke kaum zu verkennen ist. Reine vollendete, makellose Schönheit, die vollkommene Harmonie, ist nicht mehr Kunst, sondern Kitsch. "Was wir Schönheit nennen, gehört weder der reinen Ordnung, noch dem reinen Chaos an. Schönheit entsteht vielmehr überall dort, wo das Chaos in die Ordnung oder wo die Ordnung in das Chaos mündet in jenem irreversiblen Schritt, der sich nicht voraussehen, der sich nicht berechnen und der sich daher auch nicht umkehren, nicht wiederholen lassen kann. Schönheit ist gleich der offenen, irrationalen Ordnung des Überganges, und so ist sie ihrem eigenen Prinzip nach vergänglich, fragil, gefährdet und je nur einmalig." (F. Cramer/ W.
Kaempfer). Wahre Kunst ist stets ein Werdendes, niemals ein für alle Zeiten Vollendetes; sie ist vielmehr das unermüdliche Streben nach dem Schönen, durch das sie das Häßliche, das Unharmonische zu überwinden sucht. Das hat schon Platon erkannt, und das gilt auch heute noch. Weder das Häßliche allein für sich genommen, noch das reine Schöne können Gegenstand der Kunst sein, sondern Kunst ist ein schöpferisches Können, das dem Häßlichen immer mehr Schönheit abringt. Häßlich ist das ungeformte Rohmaterial und künstlerisch ist der Weg, der Prozeß, durch den daraus immer mehr Schönheit hervorleuchtet. Kunst ist nur dort in diesem Werden zu finden; sobald es sich vollendet hat, ist auch die Kunst erloschen und muß von da an auf einem neuen Weg gesucht werden. Das heißt nicht, daß man die alte Kunst ignorieren soll, wenn man moderner Künstler sein will. Im Gegenteil, man muß sich erst an ihr schulen, um über sie hinwegschreiten zu können, und wer die alte Kunst nicht wenigstens in ihren Grundzügen beherrscht, wird niemals neue Kunst hervorbringen können. Man muß Altes ganz konkret durch tätige Auseinandersetzung überwinden, dann wird man vielleicht auch Neues schaffen können. Was auch immer bereits fertig gegeben ist, kann nur das häßliche Rohmaterial sein, das der Künstler schaffend überwindet. Das ist der Stoff, den der Künstler braucht; ohne ihn könnte er nicht schaffen, aber er muß ihn, wie sich Schiller ausdrückt, durch sein kreatives Wirken derart vertilgen, daß er sich nicht mehr in seiner Eigenart geltend macht, sondern dem höheren Ziel, das sich der Künstler setzt, dient. Wollten wir als moderne Künstler etwa heute so Theaterspielen wie ehemals die Griechen, so würden wir bloßen "Stoff" auf die Bühne stellen; und der bloße Stoff ist häßlich, auch wenn er einmal die herrlichste Blüte griechischen Lebens war. Eine getreue Nachahmung des antiken Spiels könnte höchstens von historischem Interesse sein. Aber wir müssen von dem, was damals lebendige Kunst war, ausgehen, es nachempfinden, verstehen, und dann mit unseren Mitteln in eine ganz andere Richtung führen, die unserem künstlerischen Bedürfnis angemessen ist. Moderne Ästhetiker wie Theodor Adorno haben geradezu in der Zerrüttung, in der Zertrümmerung des Überkommenen das "Echtheitssiegel der Moderne" gesehen: "Zur Selbstverständlichkeit wurde, daß nichts, was die Kunst betrifft, mehr selbstverständlich ist, weder in ihr noch in ihrem Verhältnis zum Ganzen, nicht einmal ihr Existenzrecht." Tatsächlich ist heute der Begriff "Antikunst" salonfähig geworden: "Kunst ihrerseits sucht Zuflucht in ihrer eigenen Negation, will überleben durch ihren Tod." Aber bloß das Alte zu zerschmettern begründet noch keine neue Kunst. Das Alte muß nicht zertrümmert werden, sondern soll als Rohstoff dienen für Neues. Der Bildhauer würde schlecht fahren, der den Marmorblock, aus dem er seine Statue meißeln will, zuerst vollkommen zertrümmerte. Man muß nicht das Häßliche noch häßlicher machen wollen und das dann Kunst nennen. Das Alte zertrümmern wollen wird nur jener schwächliche Künstler, der sich innerlich von ihm nicht lösen kann, weil ihm die eigentliche schöpferische Kraft fehlt. Jeder rohe Stoff an sich ist häßlich, wenn man ihn mit den Augen des schaffenden Künstlers ansieht, und wäre es selbst die vollendete griechische Kunst. Der rohe Marmor erscheint dem Künstler häßlich, bevor er ihn durch sein Tun in Schönheit erstrahlen läßt, denn er sieht in ihm jenes Mehr, das er unbehauen nicht zeigt, das aber der Künstler daraus befreit. Ein historischer Stoff, seiner chronologischen äußeren Ereignissen nach genommen, ist dem Dichter häßlich, und erst durch das, was der Dichter daraus macht, wird er schön und zeigt seine tieferen Geheimnisse. Ebenso ist der bloße Gedankengehalt eines Gedichtes noch völlig unkünstlerisch, und sei er noch so gescheit und tiefsinnig, erst durch die Form, die ihm der Künstler gibt, wird er schön. Dann erst spricht das Gedicht den ganzen Menschen an, nicht nur seinen Intellekt, sondern auch sein Gefühl und seinen Willen – und alle Kunst muß zum ganzen Menschen sprechen, muß Kopf und Herz und Hand versöhnen, sonst ist sie keine Kunst, denn darin, daß sie denn ganzen Menschen innerlich mit sich versöhnt, liegt ihre wahre lebensspendende Bedeutung für ihn. Nur was die Seele belebt, führt sie zum Schönen, durch das Häßliche wird sie zerstört. Vieles, was sich heute als Kunst ausgibt und aus Profitgier oder Propagandagründen gefördert wird, ist nichts anderes als ein naturalistisches Abbild eines zerstörten Seelenlebens, damit nicht Kunst, sondern – Antikunst! Allerdings – bloße unbeherrschte Emotion alleine spricht zwar zu Tieferem im Menschen als bloß zum Kopf, sie ist aber dennoch noch kein wirkliches künstlerisches Stilmittel. Erst wenn sich die Emotionen zum echten Gefühl harmonisieren und zum vom Schauspieler voll beherrschten Tun läutern, entsteht eine heilsame ästhetische Wirkung. Der Alltagsmensch in uns wird oft von blinden Emotionen beherrscht; der Künstler muß sie überwinden und zum schönen Gefühl und zum gezielten Wollen führen. Jedes Gefühl, das so entsteht, ist schön, auch wenn es tief traurig ist oder gar Böses ausdrückt. Und jedes Gefühl, das wir so künstlerisch in uns erregen, hat auf uns Schauspieler und, wenngleich auch in viel geringerem Maße, auf das Publikum eine unterschwellige psychohygienische Wirkung. So schrecklich können die Gefühle, die so erlebt werden gar nicht sein, daß sie nicht positiv, gesundend auf uns zurückwirken. Daher konnte Aristoteles auch sagen, daß das Theater das Publikum durch Furcht und Mitleid zur Katharsis, zur seelischen Läuterung führen soll. Unsere moderne vollkommen arhythmische Zeit bedarf einer derartigen Seelentherapie nur
allzusehr, und die Kunst kann dazu beitragen.
Alle Kunst ging ursprünglich von der unmittelbar im eigenen Organismus erlebten idealen Weltharmonie aus, die sich hinter allen Naturerscheinungen verbirgt, im vielgestaltigen Jahres- und Tageslauf genauso wie im menschlichen Atem- und Pulsrhythmus, und der Künstler versuchte sie seinen Werken einzuprägen und dadurch den Sinnen zu offenbaren. Das verborgene Schöpfungswort der Götter wollte er sichtbar, hörbar, fühlbar machen, und alle Kunst entsprang derart einer tief religiösen Gesinnung. "Am Anfang war das Wort", läßt Johannes sein Evangelium beginnen, und nirgendwo sonst in der Natur kommt es so deutlich und offen und so vollständig zur Erscheinung wie im Menschen selbst. Der Mensch, so empfand etwa der Grieche, ist ein Mikrokosmos, ein vollkommenes Abbild der ganzen großen Welt, des Makrokosmos, und ihrer inneren Ordnung. Darum ist auch der Mensch als einziges Erdenwesen der Sprache mächtig. "Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns" – in jedem einzelnen Menschen. Am Anfang, so könnte man sagen, stand das Schöpfungswort der Götter, am Ende steht das individuelle künstlerisch schöpferische Menschenwort. Das gilt es erst noch zu erringen, denn wir haben es noch nicht, jedenfalls noch lange nicht vollkommen in unserem Besitz. Warum nicht ? In den Sprachlauten selbst wirkt noch ein allgemein menschliches Prinzip; der Empfindungsgehalt und die Formkraft der Laute, auch wenn sie uns meist kaum zu Bewußtsein kommen, wirken auf alle Menschen, welcher Kultur oder Muttersprache sie auch angehören, ob sie Europäer, Chinesen oder Bantu sind, in gleicher Weise. Die Laute als solche sind universell menschlich, nicht individuell. Und was sich aus den Lauten heraus zum Wort verdichtet, zu den einzelnen Sprachen, darin lebt immer noch etwas Volksmäßiges, Kollektives. Wäre das nicht der Fall, könnte die Sprache kein taugliches Kommunikationsmittel zwischen den Menschen sein; sie ist notwendig überindividuell. Und doch ist sie zugleich auch ganz individuell. In der ganz persönlichen Gestaltung des gesprochenen Wortes, im Tonfall der Stimme, in ihrem besonderen Rhythmus und Tempo, in der persönlichen Wortwahl, im reicheren oder ärmeren Wortschatz, im ganz persönlichen Sprachstil, im geschliffenen oder unbeholfenen Ausdruck, lebt wirklich unmittelbar der individuelle Mensch auf. Was wir als Individuum sind, das offenbaren wir weniger durch den gedanklichen Inhalt, aber durch den Klang, die Gestaltung unserer Sprache. Was wir sprechen, ob Dummes oder Gescheites, Wichtiges oder Belangloses, erzählt weniger über unser eigentliches Wesen, über unseren Charakter, über unsere Stärken und Schwächen, als vielmehr die Art, wie wir es sagen. Nur bemerken das die wenigsten Menschen und nur wenige werden es akzeptieren wollen, bedeutet es doch nicht weniger, als daß wir in unserer Sprache, uns völlig unbewußt und von uns nicht kontrolliert, die verborgensten Geheimnisse unseres Herzens vor aller Welt bloßlegen. Aber genau so ist! Als Sprachkünstler, als Schauspieler müssen wir gerade für diese Sphäre ganz bewußt erwachen. Hier begegnen wir unserem eigenen Ich und hier können wir den Rollencharakter, indem wir ihm unsere Sprache anpassen, glaubhaft verkörpern. Nicht zertrümmern, nicht verleugnen müssen wir das "Götterwort", das sich in den Lauten und Volkssprachen ausdrückt, aber wir müssen es individualisieren. Die Sprache geht, das zeigt sich besonders an der Dichtkunst, seit langem diesen Weg vom anfänglichen kollektiven Erleben im Epos zum ganz individuellen Ausdruck in der Lyrik.
Wenn wir uns künstlerisch mit dem Hexameter auseinandersetzen, uns ganz in ihn einleben, dann kommen wir geradezu an den Quellort aller Sprachkunst, und er ist das beste Mittel um unser Gefühl und unseren Willen künstlerisch zu erziehen. Am besten fängt man damit an, ihn streng rhythmisch, beinahe monoton anzustimmen, um ihn dann später immer lebendiger und vielgestaltiger werden zu lassen, indem man ganz individuell immer häufiger das Tempo wechselt und die Betonungen einmal stärker, einmal schwächer setzt. Dann wird man sehr schnell bemerken, daß gerade dadurch wie von selbst auch der Gedankengehalt des Textes immer klarer wird, ohne daß man gesondert darüber nachdenken müßte, während man, solange man monoton sprach, den Inhalt beinahe verschlief. Hier zeigt sich auch die besondere Bedeutung Josef Weinhebers für die Dichtkunst, denn er hat die klassischen Versformen der Griechen durch seinen individuellen Sprachrhythmus der Moderne nähergerückt. Sosehr man ihn vielleicht auch als Mensch tadeln muß, sosehr darf man ihn als Künstler schätzen.
Elegisches Distichon
Im Hexameter steigt des Springquells flüssige Säule,
im Pentameter drauf // fällt sie melodisch herab.
F. Schiller
Hast du die Welle gesehen, / die über das Ufer einherschlug?
Siehe die zweite, sie kommt! // Rollet sich sprühend schon aus!
Gleich erhebt sich die dritte! / Fürwahr, du wartest vergebens,
daß die letzte sich heut // ruhig zu Füßen dir legt.
Ja, vom Jupiter rollt ihr, / mächtig strömende Fluten,
über Ufer und Damm, // Felder und Gärten mit fort.
Einen seh ich! Er sitzt / und harfeniert der Verwüstung;
Aber der reißende Strom // nimmt auch die Lieder hinweg.
J. W. Goethe
Die Elegie ist ursprünglich die Totenklage, in der sich das persönliche Leid ausdrückt, das man über den Tod eines nahen Verwandten empfindet. Die Elegie ist ganz entschieden von persönlichen Gefühlen geprägt und leitet damit bereits von dem noch ganz überpersönlich erlebten Epos zum ganz persönlichen Ausdruck der Lyrik über. Durch den Pentameter mit seiner scharfen Mittelzäsur, wo zwei betonte Silben aufeinandertreffen und dadurch den harmonisch fortfließenden Sprechrhythmus brechen, wacht der Mensch immer wieder aus der träumerischen Stimmung auf, in die ihn der Hexameter führt. Im Traum fühlen wir uns mit der erlebten Traumwelt wie in eins verwoben, wir erleben einen reichen Inhalt, aber wir stellen uns kaum als eigenständiges Wesen diesen Erlebnissen gegenüber, sondern fühlen uns selbst als untrennbarer Bestandteil dieses Geschehens. Der Pentameter reißt uns immer wieder aus dieser Stimmung heraus und führt uns zum Bewußtsein unserer selbst. Wir sind nicht mehr bloß miterlebender Teil des Geschehens, sondern wir sind uns jetzt klar bewußt, daß wir es sind, die das erleben. Das ist so ähnlich, wie es einem manchmal in den Träumen passieren kann, wenn man zwar noch träumt, aber zugleich auch ganz bewußt weiß, daß man jetzt träumt. Im Epos träumte man von den Götter- und Heldentaten; durch den Pentameter wird man aus dem bloßen Träumen herausgerissen, man stellt sich der Handlung mit persönlichen Gefühlen gegenüber. Es ist nicht mehr das Leid der Götter und Helden, daß ich in mir nacherlebe, sonder die persönliche Trauer, die persönliche Freude ergreift mich.
Das Epos
Das Epos lebt vorallem von der rhythmischen, konsonantischen Gestaltung. Der Reim, ein sehr abstrakt intellektuelles Prinzip, spielt hier kaum eine Rolle. Oft wird - und zwar weniger in der melodiösen griechischen Kunst, als vielmehr in der sehr willensbetonten germanischen Dichtung - durch Alliteration die Wirkung der anlautenden Konsonanten verstärkt. Das Willensprinzip steht hier ganz im Vordergrund.

|



